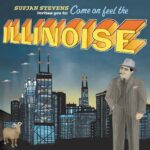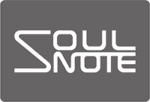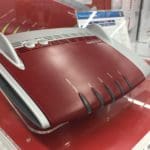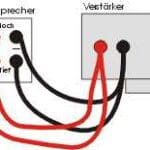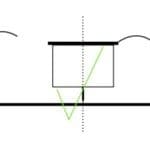AUDIOSAUL aktuell
Sehen Sie hier nach Themen geordnet,
was sich seit Ihrem letzten Besuch
auf unserer Webseite getan hat.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern!
Und sollten Sie einen Artikel zum Nachlesen nicht mehr finden können, schauen Sie bitte im Archiv nach. Danke!
Lesen Sie hier aktuelle Beiträge
1) Aktuelle Infos
Aktuelle Infos
23. April 2024Analoge Legenden abzugeben!
Heute biete ich Ihnen ein paar absolute analoge Leckerbissen.
Ob Sie Musik in ihrer allerhöchsten Güte genießen möchten, ob Sie Sammler sind und nach raren Prunkstücken Ausschau halten,oder vielleicht gar beides …… mit diesen Angeboten erreichen Sie Ihre Ziele spielend – und wenn sie noch so hoch gesteckt sind!
Finden Sie mehr Informationen über das heutige Angebot in meinem ausführlichen Bericht:https://audiosaul.de/zarathustra-s4-und-pluto-audio-7a-prestige-revision-teil-1-2/
Abzugeben sind:
1x Zarathustra S4 mit Dr. Fuß-Netzteil
Das Original- Musterstück von 1988 mit der Original (verklebten) Record-Interface-Matte!Bei dem Tonarm-Loch handelt es sich um eine ovale SME-Langloch-Bohrung. Passend für die meisten 9″ und 10″ SME-Arme, für Pluto-Audio-Tonarme und natürlich für weitere Arme mit einem SME-Fuß.Dem Laufwerk wurde ein Netzteil von Dr. Fuß gegönnt, mit dem die Sollgeschwindigkeit fein justiert und von 33,3 auf 45 U/Min umgeschaltet werden kann.Ehemaliger Kaufpreis: 6.500,- DM plus 800,- € für das Dr. Fuß Netzteil.
Zarathustra S4 – Tonarm und Tonabnehmer sind nicht Teil des Angebotes !!
Preis für das S4-Laufwerk inkl. Dr. Fuß-Netzteil: 2.800,- €
1x Zarathustra S4 mit Original Zarathustra Netzteil
Dieses Laufwerk stammt ebenfalls aus der Zeit, als die Record-Interface-Matte noch angeboten wurde. Die Matte ist eines der Geheimnisse dieses Laufwerks. Keine der nachfolgenden Plattentellerauflagen konnte diesem Laufwerk zu solchen klanglichen Höhenflügen verhelfen.Das Original Netzteil (33,3 und 45) macht dieses Laufwerk klanglich und optisch perfekt.Ehemaliger Kaufpreis: 6.500,- DM plus 2.500,- DM
Zarathustra S4 – Werbefoto
Preis für das S4-Laufwerk inkl. Original Zarathustra Netzteil: 3.600,- €
1x Pluto Audio 7A Prestige – Titan massiv
Eine Augenweide aus massivem Titan, hochglanzpoliert – mit einer Deskadel-Gold-Innenverkabelung.Dieser Tonarm wurde in reiner Handarbeit hergestellt und poliert. Jedes aufwendig entwickelte Bauteil entstand in einer kleinen Manufaktur in Hengelo (Niederlande) vom Meister Eduardus Driessen höchstpersönlich.Dieser Arm ist seit Jahrzehnten nicht mehr käuflich zu erwerben, weil der ehemalige Kaufpreis von 17.500,- DM heute nicht mehr realisiert werden könnte.
Foto folgt
Preis für den Tonarm Pluto Audio 7A Prestige: 3.800,- €
1x Pluto Audio 6A Prestige – schwarz/chrom
Mit dem 6A Prestige schaffte es Eduardus Driessen in den 80 Jahren locker, klanglich zu den angesagten Spitzen-Tonarmen der damaligen Zeit aufzuschließen und sogar an ihnen vorbei zu ziehen. Genau wie bei den großen Modellen aus massivem Titan ist auch beim 6A Prestige jedes einzelne Bauteil in reiner Handarbeit entstanden.Ehemaliger Kaufpreis: 4.600,- DM
Foto folgt
Preis für den Tonarm Pluto Audio 6A Prestige: 1.400,- €
1x van den Hul The Grasshopper
Bei diesem Angebot muss ich mich auf die Aussagen des Vorbesitzers beziehen – sie kommen also ohne Gewähr.Demnach handelt es sich um ein vom Hersteller auf den Grasshopper-Stand hochgerüstetes System mit der Seriennummer: BF2L200. Laut zugehöriger Holz-Schatulle handelt es sich um einen Typ III GLA.Da ich mich mit v.d.H.-Produkten nicht auskenne – bitte ich bei Interesse, selbst beim Hersteller nachzufragen.Über das Alter des Tonabnehmers liegen mir auch keine zuverlässigen Angaben vor.Der Neupreis liegt bei rund 4.400,- €.
Foto folgt
Preis für den Tonabnehmer v.d.Hul Grasshopper III GLA: 1.200,- €
1x Goldring Ethos
Bei diesem Tonabnehmer handelt es sich um ein Ausstellungsstück, das etwa 3 Stunden gelaufen ist.Auf Grund eines bevorstehenden Umzugs trennen wir uns von unseren analogen Produkten und dazu gehört eben auch dieser Tonabnehmer.Listenpreis: 1.160,- €
Foto folgt
Preis für den Tonabnehmer Goldring Ethos: 850,- €
Goldring Ethos
Bei Kombinationskauf Laufwerk/Tonarm/Tonabnehmer:20% Nachlass möglich. [...]
Weiterlesen...
9. Dezember 2020Zarathustra S4 und Pluto Audio 7A Prestige – Revision Teil 1
Hinweis: Dieses Laufwerk und auch der Tonarm stehen zum Verkauf!
Bitte sprechen Sie uns an.
Sie haben weder ein Zarathustra-Laufwerk noch einen Pluto-Audio-Tonarm?
Macht nichts! Lesen Sie doch einfach trotzdem weiter und erfahren Sie ein wenig mehr über die vielen Aspekte, die es bei der Entwicklung eines Laufwerks oder eines Tonarms zu bedenken gibt.
Wenn man sich so manche Plattenspieler anschaut, meint man ja schnell, sie seien in wenigen Minuten montiert und spielbereit. Aber stimmt das auch? Lesen Sie weiter und beurteilen Sie dann selbst.
In diesem ersten Teil geht es um das Laufwerk S4 von Zarathustra.
Zum zweiten Teil des Berichts, in dem es dann um den Tonarm Pluto Audio 7A Prestige geht, klicken Sie auf diesen Link.
Meine beiden hier gezeigten Komponenten stammen aus dem Jahr 1988 und hatten schon seit langem mal wieder eine Überprüfung nötig. Da sich ein Kunde für den Kauf der Objekte interessierte, beschloss ich, mir mal einen ganzen Tag dafür frei zu nehmen und die nächste gründliche Revision in Wort und Bild festzuhalten.
Nach der Demontage des Tonarmes sah es dann zunächst einmal so aus:
Ein paar Worte über dieses Laufwerk
Bei meinem S4-Laufwerk handelt es sich tatsächlich um den allerersten S4-Plattenspieler, den Simon Yorke jemals gebaut hat. Es ist ein Vorserienmodell, das dann aber genau so in die Serie ging.
Und das alles kam so:
1987 besuchten mich Eduardus Driessen von Pluto Audio und Simon Yorke von Zarathustra.
Mark Levinson hatte sich das S5-Laufwerk ausgesucht, um es unter dem Namen Cello zu vermarkten. Cello, so hieß die damalige Marke, die Mark Levinson zusammen mit Tom Colangelo gegründet hatte.
Mark gefiel es nicht, dass der Zarathustra eine matte Oberfläche hatte und der Pluto-Tonarm, den er ebenfalls bei seinen Cello-Plattenspielern verwenden wollte, aus glänzend poliertem Titan bestand. Er bat daher beide Entwickler, gemeinsam einen Weg zu finden, das optisch besser aufeinander abzustimmen.
Simon besuchte deshalb Eddy in Hengelo (NL) und beide machten sich auf den Weg zu mir, da ich 1986 die Distribution für Pluto Audio übernommen hatte. Sie wollten mich davon überzeugen, dass ich meine Tätigkeit auch unbedingt auf Simons Produkte ausdehnen müsste.
Natürlich fühlte ich mich geschmeichelt und hätte gerne den Vertrieb übernommen, aber eine Marke zu vertreiben, die lediglich ein einziges Laufwerk zum Preis von weit über 10.000,- DM produzierte (das Cello sollte sogar 16.000,- DM kosten), war nicht besonders reizvoll und ich fragte Simon, ob er nicht auch ein günstigeres Laufwerk konstruieren kann.
Das lehnte Simon entrüstet ab und meinte, dass er entweder das beste Laufwerk der Welt bauen wollte oder gar keins.
Ich legte Argumente nach und schilderte ihm meine Sichtweise:
“Das S5 hat ein schweres und zerbrechliches Glasgehäuse.
Das S5 hat eine schwere und fast ebenso zerbrechliche Schieferplatte.
Das S5 hat ein großes und teures Netzteil.
Solche Teile kann man doch zunächst weglassen und dann als optionales Zubehör zum Aufrüsten anbieten!”
Mit diesen Aussagen hatte ich wohl Simons Interesse geweckt und er versprach zumindest mal darüber nachzudenken.
Einige Wochen später bekam ich überraschend Post von ihm. Ein ziemlich großes und schweres Paket. In dem Karton befand sich das S4- Laufwerk, was Sie hier auf den Bildern in diesem Bericht sehen können.
Ich war auf der Stelle begeistert, montierte einen Pluto Audio Tonarm, probierte ein paar gute Tonabnehmer … und bestellte sofort ein halbes Dutzend dieser Laufwerke.
Das S4 verkaufte sich außerordentlich gut und schon 1989 erreichte mich ein Glückwunschschreiben von Simon mit einem Zertifikat. Darin bescheinigte er mir, dass nirgendwo auf der Welt mehr Zarathustra-Laufwerke verkauft worden sind als in Deutschland.
Woran lag das?
Es war dieses Design, diese konsequente Konzentration auf das Wesentliche und das Weglassen aller Dinge, die überflüssig waren und daher nur von der eigentlichen Aufgabe eines Plattenspielers ablenkten. Der Name “Zarathustra” war für Simon nicht nur ein Name, er war Programm. Eine Lebenseinstellung.
Weiterer Werdegang der Marke Zarathustra
Leider entwickelte sich Simons privates Leben in den folgenden Jahren nicht positiv und der finanzielle Druck stieg. Ich übergab deshalb die Distribution an einen Interessenten mit größerem Budget als er mir zur Verfügung stand. Allerdings ging der Plan nicht auf.
Kurz danach verschwand Simon und lebte eine Weile in Indien.
Den Markennamen Zarathustra und das Design des S4 hatte mein Nachfolger Simon abgerungen. Als Simon nach Europa zurückkehrte, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine nachfolgenden Laufwerke einfach “Simon Yorke” zu benennen und mit einem neuen Design zu versehen.
Demontage des Laufwerks.
Haben wir den Tonarm vom S4 demontiert, entfernen wir den Antriebsriemen und heben den Plattenteller ab.
Doch Vorsicht!!!
Der Plattenteller klemmt dabei nämlich leicht die Lagerachse fest und dann zieht man sie mit nach oben, was gefährlich werden kann.
Im Lager herrscht dann nämlich ein ansteigender Unterdruck. Irgendwann wird der Unterdruck so stark, dass die Achse aus dem Plattenteller rutscht und wie ein Bolzen beim Gewehr dafür sorgt, dass die beiden Lagerkugeln aufeinander prallen. Möglicherweise überleben sie das (die Kugeln), aber wahrscheinlich ist, dass sie Beschädigungen im Kontaktbereich davon tragen, die den sauberen Lauf von da an stören.
Also besser:
Holen Sie sich Hilfe. Heben Sie den Plattenteller (fast 15 kg!) so waagerecht wie möglich an, ohne ihn zu verkannten. Lassen Sie die zweite Person auf die Mittelachse drücken, damit die unten bleibt.
Zur Plattentellerauflage
Einen nicht geringen Teil seines klanglichen Erfolges hatten die ersten Zarathustra-Laufwerke der Record-Interface-Matte zu verdanken, die fest mit dem Plattenteller verklebt wurde. Die Produktion dieser Auflage wurde Ende der 1980-er eingestellt, nachdem alle Welt nur noch CD-Player kaufte. Es folgte eine lange Phase des Experimentierens. Alle nachfolgenden Auflagen hatten ihre Vor- und Nachteile und man konnte mit ihnen die Stimmung der Musik beeinflussen. An die Neutralität und klangliche Bandbreite der Record-Interface-Matte kam jedoch keine andere Auflage heran.
Es geht weiter.
Ist der Plattenteller entfernt und liegt er auf einer weichen Unterlage, kann man nun die Lagerachse mit leichten Drehbewegungen langsam (!) aus dem Lager heben.
Hinweis:
Geht das sehr leicht oder gibt es bei Ihnen gar keinen Unterdruck im Lager, dann stimmt was nicht mit dem Lager. Im besten Fall hatten Sie einfach nur zu wenig Öl im Lager. Dann muss man hoffen, dass es nicht all zu lange trocken gelaufen ist und die Achse keinen Schaden genommen hat.
Kommen Sie aber bitte nicht auf die Idee, die Achse schleifen und polieren zu lassen. Dadurch würde sie zu dünn werden. Der Durchmesser der Achse ist genau berechnet und darf nicht kleiner werden.
Im Lager wurden gelöcherte Teflonflächen eingeklebt (im Bild in gelb zu sehen). In diesen Löchern muss sich Öl sammeln können. Durch die Drehbewegung beim Spielen zieht die Achse (Stichwort: Oberflächenspannung) fortlaufend Öl mit sich und dieser Ölfilm liegt dann zwischen Achse und der Teflonschicht.
So muss es sein – aber dazu später noch mehr.
Lager demontieren
Um das Lager ausbauen zu können ohne den Gewindering zu beschädigen, benötigen Sie Spezialwerkzeug wie es auf dem Bild zu sehen ist. Ist das nicht vorhanden, suchen Sie sich zwei kurze Metallstäbe oder Schrauben, die genau in die beiden Löcher des Gewinderings passen. Sind sie zu dünn, dann stellen sie sich nur schräg und Sie können beim Aufdrehen abrutschen und sich verletzen. Nun legen Sie einen langen Gegenstand wie z.B. einen Kochlöffel zwischen die beiden kurzen Stäbe, benutzen ihn als Hebel und drehen den Gewindering ab. Danach kann man das Lager nach unten entfernen.
Ausgleichsgewicht demontieren
Mit einem passenden Innensechskantschlüssel schrauben wir jetzt das Tonarm-Ausgleichsgewicht ab. Dieses ist grundsätzlich ausgelegt für mittelschwere bis schwere Tonarme. Sollten Sie einen leichten Tonarm verwenden wollen, brauchen Sie sich aber auch keine Sorgen zu machen. Das funktioniert auch mit dem gleichen Gewicht. Eventuell werden Sie später nur an dem Fuß vorne links ein paar Distanzscheiben mehr unterlegen müssen.
Tipp:
Wollen Sie das volle Klangpotential eines Zarathustra-Laufwerks ausschöpfen, sollten Sie bei einem schweren oder mittelschweren Arm bleiben. Ein Zarathustra kann durch eine fulminante, abgrundtiefe und rabenschwarze Basswiedergabe überzeugen, ohne sich dabei im Hochtonbereich limitierend auszuwirken. Eine übertrieben analog wirkende Wiedergabe mit “Hamilton-Effekten” ist nicht sein Ding.
Terminals demontieren
Nun brauchen wir einen kleinen langen Innensechskantschlüssel, um von unten die Befestigungsschrauben der Terminals lösen zu können. Sind sie gelöst, lassen sich die Terminals einfach von den Achsen abziehen.
Kontrolle des Subchassis
Nun sind alle Bauteile vom Subchassis entfernt die wir abbauen können. Die drei seitlich aus dem Chassis ragenden Stangen sollten wir auf keinen Fall entfernen, sondern lediglich daraufhin überprüfen, ob sie auch noch wirklich fest im Chassis stecken oder ob sie wackeln.
Haben wir uns von ihrem festen Sitz überzeugt, können wir uns mit der Reinigung und der nachfolgenden Montage des Laufwerks befassen.
Womit sollte ich die Teile reinigen?
Eigentlich reicht es aus den Staub abzuwischen. Hat sich Nikotin oder anderes auf der Oberfläche abgesetzt, verwende ich zur Reinigung und zur Pflege der Oberflächen handelsübliches Babyöl. Einfach deshalb, weil man die glasgestrahlten Oberflächen damit wunderbar sauber bekommt und das Öl nebenbei auch noch angenehm riecht.
Das Subchassis …
besteht aus mehreren Schichten Zitronenholz.
Was hier jetzt fast nach Voodoo klingt und manche mögen sich auch schon wieder vorstellen, dass es sich dabei um speziell geweihte Bäume handelt, die von Jungfrauen in einer Vollmondnacht … ach lassen wir das.
Dieses Zitronenholz ist nicht wirklich etwas besonderes – wir können es am besten mit gewöhnlichem Sperrholz vergleichen. Wichtig für das Klang-Ergebnis ist nur, dass die Oberfläche gebeizt und nicht gespachtelt und lackiert wurde.
Sicher – so ein offenporig gebeiztes Chassis wirkt optisch nicht sonderlich edel. Man kann schon verstehen, dass designorientierte Mitmenschen den Wunsch verspürt haben, die Oberfläche mit einem deckenden Metallic-Lack zu versehen. Klanglich jedoch kommt das einer Manipulation, manchmal sogar einer Zerstörung gleich.
Das größte Problem besteht darin, dass Sie bei den lackierten Chassis nicht herausfinden können was Sie da genau besitzen, ohne es zu beschädigen. Was verbirgt sich also hinter dieser schönen Fassade? Ist es ein noch soeben gut klingendes Subchassis oder ist es völlig indiskutabel?
Nun gut – dieses Subchassis hier ist ein Original wie sich das gehört. Zur Reinigung und Pflege wische ich es ebenfalls mit ein paar Tropfen Baby-Öl sauber und mit einem neuen Lappen wieder trocken.
Metallteile reinigen
Bei den Metallteilen handelt es sich überwiegend um Edelstahl, der glasgestrahlt wurde. Das kann nicht rosten und das sieht gut aus. Wenn Sie doch so etwas wie Rostflecken entdecken, dann handelt es sich dabei um Flüssigkeiten, die auf dem Stahl getrocknet sind. Auch die lassen sich mit dem Baby-Öl einfach wegwischen.
Das alte Öl aus dem Lager entfernen.
Hierzu verwenden wir einfach Papier-Küchentücher. Drehen Sie eine Ecke zu einer Rolle und schieben Sie das Papier drehend in das Lager. Beim ersten mal wird es sich ziemlich stark voll Öl saugen und Sie werden erschreckt darüber sein, wie schmutzig das ist.
Nach und nach werden die Küchentücher aber immer sauberer das Lager verlassen.
Die untere Lagerkugel begutachten.
Drehen Sie das Lager um und prüfen Sie, ob die Kugel heraus fällt oder ob sie sich mit einer langen Pinzette lösen lässt. Wenn ja, holen Sie sie heraus und prüfen Sie die Kugel auf plattgeschliffene Stellen. Ansonsten leuchten Sie mit einer Taschenlampe in das Lager und versuchen Sie auf diesem Weg die Kugel zu begutachten. Haben Sie den Verdacht, dass die untere Kugel nicht mehr in Ordnung ist, geben Sie mit einem Schraubenzieher und einem kleinen Hämmerchen ein-zwei kurze, harte Schläge auf die Kugel. Dabei muss sie sich lösen und Sie können sie herausnehmen.
Sollte die Kugel tatsächlich eine plattgeschliffene Stelle haben und Sie keinen Ersatz beschaffen können, dann achten Sie einfach beim Einsetzen darauf, dass die platte Stelle nicht wieder genau oben zu liegen kommt.
Wer sicher gehen will, dass die Kugel sich später nicht verschieben oder verdrehen kann, der kann jetzt einen winzigen (!!) Tropfen Superkleber auf die Kugel geben und sie damit unten im Lager verkleben. Dazu benötigen Sie eine lange Pinzette, die bis hinunter in das Lager reicht.
Die Kugel an der Achse prüfen
Ist sie in Ordnung, prüfen und reinigen wir die Achse selbst mit Autosol oder ähnlichem.
(Aber unbedingt hinterher mit Babyöl sämtliche Autosol-Rückstände entfernen!!!)
Die Achse selbst darf leichte Riefen aufweisen. Die kommen davon, dass die Achse in der gelöcherten Teflonschicht läuft und mit der Zeit selbst bei bester Ölung einfach ein paar „Laufspuren“ entstehen. Das ist in der Regel ohne Bedeutung. So lange Sie die Riefen nicht deutlich mit dem Finger spüren können brauchen Sie sich nicht zu sorgen.
Hinweis:
Füllen Sie jetzt noch nicht wieder das Öl in das Lager, das kommt erst viel später!
Die Montage
Wir beginnen die Montage damit, das Lager ohne Achse und ohne Öl in des Subchassis zu schrauben. Ohne Öl deshalb, weil wir das Subchassis noch mehrmals kopfüber halten müssen und das Öl dann immer wieder herauslaufen würde.
Legen Sie die große Unterlegscheibe über das Gewinde und drehen Sie dann den Gewindering fest. Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug oder wie oben beschrieben den Kochlöffel und die beiden kurzen Stangen/Schrauben.
Ziehen Sie den Ring ruhig ordentlich fest, denn es klemmt das Holzchassis ein und dieses Material arbeitet je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. “Ordentlich fest” ist gut. Auf gar keinen Fall darf das Lager wackeln oder durchrutschen wenn Sie versuchen, es mit der Hand zu drehen. Das Lager muss mit dem Chassis zu einer Resonanz-Einheit verschmelzen – das ist ganz wichtig für den Resonanz-Kreislauf – dazu später mehr.
Nun legen wir das Subchassis mit der Oberseite nach unten auf den Tisch und stecken die drei Terminals so auf die drei Achsen, dass wir an die Innensechskantschrauben heran kommen.
Welches Terminal Sie auf welche Achse schieben, ist dabei vollkommen egal – sie sind alle gleich.
Extrem wichtig ist allerdings der richtige Abstand zum Lager. Hierzu benutzen wir das zweite Spezialwerkzeug von Simon Yorke – eine Holzschablone, die man sich auch selber erstellen kann.
Wir beginnen mit einem Terminal und machen nach Belieben weiter – eine festgelegte Reihenfolge gibt es nicht.
Der korrekte Abstand zwischen Lager und Terminal ist für den Klang des Laufwerks von entscheidender Bedeutung.
Stimmt der Abstand dieser Terminals zum Lager hin, ergibt sich ein ausgeklügeltes Schwingverhalten der gesamten Konstruktion. Das Gewicht vom Plattenteller hat sich nicht einfach „so ergeben“ und bei den gewählten Federn hat man nicht etwa einfach genommen „was da war“. Alles ist Teil einer komplizierten Berechnung, die schon optisch wunderbar
funktioniert.
Wer bei einem korrekt montierten Zarathustra nämlich leicht (!) auf die Mittelachse des Lagers drückt, der kann beobachten, wie die gesamte Subchassis-Konstruktion „pumpt“ als würde das Subchassis an Stangen geführt. Da wackelt nichts hin und her, da verdreht sich nichts und da taumelt auch nichts.
Der Takt in dem das Chassis pumpt liegt bei exakt 3,2 Hz. Auch dieser Wert ist das Ergebnis einer speziellen Formel, mit der Simon Yorke es verhindern wollte, dass die Resonanz des Eigenschwingverhaltens sich auf das Klangergebnis auswirken kann.
Die Idee geht aber eben nur auf, wenn man ein S4 exakt so aufbaut, wie es Simon Yorke festgelegt hat.
Weiterer Aufbau – das Dreieck-Gestänge
Achten Sie beim Festschrauben der Innensechskantschrauben in den Terminals darauf, dass die Terminals flach auf dem glatten Untergrund liegen und sich nicht verkantet haben.
Nun können Sie das zuvor demontierte und mit Baby-Öl gereinigte Dreiecksgestänge wieder zusammenstecken und die drei Füße in die Terminals stellen. Achten Sie darauf, dass das Zarathustra-Zeichen später auch nach vorne zeigt.
Die ersten Dreiecke bestanden aus drei Stangen und das Zarathustra-Zeichen konnte man frei verschieben. Später bestand die vordere Seite (mit dem Zeichen) aus zwei kurzen Stangen. Hierdurch war noch etwas mehr Flexibilität zu erreichen.
Die Füße
Die Füße des Dreiecks haben jeweils zwei Löcher für die Stangen und zwei Schrauben zur Fixierung der Stangen. Die jetzt zu bewältigende Aufgabe liegt darin, die Stangen so zu verschieben, dass sie in jeden Fuss ausreichend weit eingeschoben sind, damit sie von der Halteschraube auch erfasst werden und die Füße dabei so auszurichten, dass sie exakt über den Terminals schweben. Das kann eine Weile dauern und ein Helfer ist dabei mal wieder gut brauchbar.
Geben Sie nicht auf, bevor sich die drei Füße nicht wirklich absolut korrekt über den Terminals befinden. Wer hier schludert, der muss sich später nicht darüber wundern, wenn es nicht klingt oder das Laufwerk „schief“ aussieht.
Tonarm-Ausgleichsgewicht wieder anschrauben
Haben wir auch das Ausgleichsgewicht gereinigt, dann können wir es jetzt wieder anschrauben. Das ist keine komplizierte Aufgabe, denn es gibt kein Langloch und so kommt das Gewicht wieder genau an die Stelle, an die es gehört. Wir nehmen einfach das Dreieckgestänge ab und schrauben das Gegengewicht an.
Lagerachse und Plattenteller montieren
Ist das gelungen, können wir das Dreieck auf den Tisch stellen, das Subchassis umdrehen und auf das Dreieck stellen.
Hierfür ist es von Vorteil, wenn man drei große, dicke Gummiringe hat, die man über die Füße schieben kann.
Wer die passenden Gummiringe nicht zur Verfügung hat, der kann sich einfach drei Bierdeckel besorgen und das Subchassis mit den Terminals direkt auf die Bierdeckel stellen. Das Dreieck braucht man dann erst mal noch nicht.
Welches Öl gehört in das Lager?
Zwar verfüge ich über ausgezeichnetes Lageröl von Pluto Audio, aber – ich mache mir da eigentlich gar keinen großen Kopf drum.
Weder die exakte Viskosität noch die Temperatur des Öls spielen bei einem Zarathustra-Lager eine entscheidende Rolle. Es darf natürlich nicht extrem zäh sein, denn dann bremst es den Teller und belastet den Motor unnötig. Es darf auch nicht verharzen.
Manche schwören auf Nähmaschinenöl, andere auf Ballistol und wieder andere auf Motoröle vom Auto.
Ich sage mir: Ein Öl, was extreme Temperaturen übersteht und über tausende von Kilometern die beweglichen Teile eines Automotors ausreichend schmiert, dass wird die Belastungen in einem Plattentellerlager ganz sicher auch heile überstehen und seine Aufgabe mit Bravour erfüllen. Oder sehen Sie das anders?
Klanglich habe ich jedenfalls zwischen verschiedenen Ölen nie Unterschiede feststellen können. Auch nicht mit viel Einbildungskraft. Aber das mag bei anderen Plattenspielern und Lagerkonstruktionen anders sein.
Und die Menge?
Hier gibt es keine Mengenangabe, nur eine einfach Methode.
Ich habe da so eine Pipette, die ich zwei mal mit Öl fülle und die ich dann in das Lager entleere. Diese Menge ist ein wenig zu viel – was ich weiß.
Nun lasse ich die Achse in das Lager gleiten. Ist die Achse weit genug eingesunken, so dass nicht mehr die Gefahr besteht, ich könnte die Achse verkanten, drücke ich ein klein wenig nach und drehe die Achse dabei.
Immer wieder beobachte ich den Spalt zwischen Lager und Achse.
Irgendwann sieht man, wie die absinkende Achse Öl oben aus dem Lager drückt.
Alles Öl, was oben herausgedrückt wird, ist zu viel. Mit einem gefalteten Küchentuch gehe ich jetzt in den Spalt zwischen Achse und Lager und das Küchenpapier saugt das überschüssige Öl auf. Nach und nach sinkt die Achse tiefer und immer wieder führe ich ein neues Stück Papier in den Spalt. Irgendwann ist es dann so weit, dass die Achse nicht mehr weiter sacken kann. Ein leichtes Klopfen auf die Achse bestätigt uns dann, dass jetzt Kugel auf Kugel liegt.
Noch ein letztes mal entferne ich das überschüssige Öl und das war es dann
Im Lager steht das Öl jetzt bis zum oberen Rand. Die Löcher in der Teflonschicht haben sich mit Öl gefüllt und genau so soll es sein.
Die Kugel am Ende der Lagerachse
Simon hat diese Kugel immer nur mit ein wenig Fett in der Mulde der Achse befestigt. Hierbei bestand aber folgende Gefahr:
Im Öl löste sich das Fett auf und die Kugel wurde nur noch durch das Gewicht des Plattentellers daran gehindert, aus der “Mulde” heraus zu fallen.
Wollte man jetzt aber irgendwann einmal den Plattenteller abnehmen und hob man dabei die Lagerachse auch nur ein paar Millimeter an, fiel die Kugel aus der Mulde heraus und setzte sich seitlich neben die untere Kugel.
Wenn man jetzt den Plattenteller drehte, dann war ein deutliches “Rumpeln” zu vernehmen und zu spüren.
Daher habe ich es immer bevorzugt, auch die obere Kugel mit einem winzigen Tropfen Superkleber in der Achsmulde zu fixieren. Ein kleiner Schlag mit einem Messerrücken reicht später aus, um die Verbindung mal wieder lösen zu können, aber im Lager bleibt die Kugel wo sie hingehört.
So – wir sind (fast) fertig.
Wer jetzt den Plattenteller einmal per Hand in Rotation versetzt, der wird seine helle Freude daran haben, wie lange der Plattenteller nachdreht. So muss es sein!
Die Revision des Zarathustra S4 ist abgeschlossen und wir können uns im zweiten Teil des Berichts um den Pluto Audio 7A Prestige kümmern.
Die Federn des Laufwerks benötigen wir erst, wenn der Tonarm und auch der Tonabnehmer montiert sind. Das Ausrichten der Federn beschreibe ich hier deshalb zwar schon – aber bitte erledigen Sie das erst, wenn Tonarm und Tonabnehmer montiert und justiert wurden.
Zu den Federn:
Zu einem S4 gehören drei Federn und ein paar Unterlegscheiben aus Kunststoff zur Höhenjustage.
Wir entfernen die dicken Gummiringe (falls wir mit ihnen gearbeitet haben) und stülpen die drei Federn über jeweils ein Kunststoffteil der Füße. Nun stellen wir das Subchassis auf die drei Füße und stellen in der Regel noch zwei Dinge fest, die wir korrigieren müssen. Erstens sind die Spaltmaße zwischen den Füßen und den Terminals unterschiedlich (dadurch steht das Laufwerk nicht “im Wasser”) und zweitens stehen jetzt auf einmal die Terminals überhaupt nicht mehr exakt über den Füßen.
Erster Schritt – Plattenspieler in die Waage bringen. (Dabei kann man wieder eine zweite Person gut gebrauchen)
Hierzu ist es zunächst wichtig, dass das Dreiecksgestänge auf einer waagerechten Ebene steht. Befindet es sich “im Wasser” müssen wir nur noch mit den Unterlegscheiben dafür sorgen, dass die drei Spaltmaße der Terminals zu den Füßen hin exakt gleich sind.
Ich verwende dazu einfach einen Post-it-Block. Zunächst ermittle ich die Menge Zettel, die in das größte Spaltmaß (Referenzmaß) passen. Dann hebe ich die Terminals mit dem kleineren Spaltmaß gemeinsam mit der Feder darunter an und lege Unterlegscheiben um den schwarzen Kunststoff-Fuß. Und zwar so lange, bis die gleiche Menge an Zetteln in den Spalt passt. Manchmal wird dadurch das ermittelte Referenzmaß etwas geringer, weil dieses Terminal durch das Ausgleichen etwas absackt. Dann entfernt man ein paar Zettel und wiederholt die Prozedur. Am Ende kann man dann noch eine Phono-Wasserwaage auf den Plattenteller legen und prüfen, ob das Subchassis tatsächlich korrekt ausgerichtet ist.
Priorität hat dabei, dass der Plattenteller genau im Wasser steht. Sollte das nur erreichbar sein, indem die Spaltmaße voneinander leicht abweichen, so können wir das getrost tolerieren.
Zweiter Schritt – Terminals exakt über die Füße bringen.
Bei diesem Schritt handelt es sich keineswegs (!!) nur um eine Handlung zur Steigerung der Ästhetik. Die Federn sind so geformt, dass die Terminals in eine bestimmte Richtung gedrückt werden, weshalb sie eben meistens nicht auf Anhieb exakt über den Füßen stehen. Wir heben jetzt die Terminals der Reihe nach an und verdrehen die Federn. Irgendwann erreichen die Federn eine Position, bei der sie die Terminals nicht mehr seitlich verschieben, sondern einen Druck genau zur Mitte oder nach außen des Plattenspielers ausüben und sich dadurch gegenseitig aufheben.
Ergebnis: Die Terminals stehen nun exakt über den Füßen. Wichtiger ist dabei, dass die Federn jetzt alle genau zur Mitte des Plattentellerlagers drücken oder alle genau vom Lager weg zeigen. Beides ist in Ordnung, denn es soll ja nur verhindert werden, dass die Federn einen seitlichen Druck auf die Terminals ausüben. Der würde nämlich dafür sorgen, dass das Subchassis taumelt, statt zu “pumpen”.
Zugegeben – man benötigt ein klein wenig Geduld, um alle drei Federn exakt auszurichten, aber ich glaube, dass man die gerne aufbringen wird, wenn man doch jetzt weiß, wieso man das tun sollte.
Doch wie bereits geschrieben – bevor wir die Federn ausrichten können, ist zunächst der Tonarm zu montieren und der Tonabnehmer zu justieren.
Lesen Sie dazu bitte den zweiten Teil des Berichts.
Zum zweiten Teil wechseln (Pluto Audio 7A Prestige)
Ach ja – ich hatte Ihnen ja noch versprochen, etwas über meine Theorie des Resonanzkreislaufs zu schreiben. Das mache ich am besten auch in einem getrennten Bericht.
Hier geht es zum Bericht Resonanzkreislauf beim Plattenspieler. (Bitte klicken) [...]
Weiterlesen...
30. April 2020Doepke DFS Audio – der audiophile Fehlerstromschutzschalter
Manchmal geschehen noch Wunder.
Nachdem ich nun über eine lange Zeit hinweg beobachten musste, dass der Doepke FI für bis zu 1.800,- € pro Stück angeboten wird und ich deshalb meinen Produktbericht offline gestellt hatte, tut sich nun etwas.Doepke hat sich dazu entschlossen, die Vermarktung ab sofort doch über Audio-Händler vorzunehmen.Zwar sind gerade die HiFi-Händler nicht unbedingt dafür bekannt, mit Mini-Margen zu rechnen, aber der große Vorteil dabei ist, dass es dem interessierten Kunden erleichtert wird, überhaupt an diesen Artikel zu gelangen und den Preis dafür vergleichen zu können.Marktregulierung nennt man so etwas. 🙂So gehe ich davon aus, dass sich die Straßenpreise schnell unterhalb der empfohlenen Listenpreise einpendeln werden.Unsere Stammkunden (mit 5% Rabatt) werden so in meinem Shop auf einen Kaufpreis von etwa 1.250,- € für den “großen” (4-er) FI und 990,- € für den “kleinen” (2-er) FI kommen können. Mit dem 4-er ersetzen Sie Ihren alten FI für alle 3 Phasen und mit dem 2-er sichern Sie nur eine Extra-Leitung für Ihre HiFi-Anlage ab – was ja in der Regel reichen sollte.
Bedenken Sie, dass Sie den Einbau unbedingt durch einen Fachmann durchführen lassen sollten.Kunden im Raum Oberhausen kann ich gerne einen “einbauwilligen” Elektriker vermitteln. [...]
Weiterlesen...
5. März 2024Qobuz – Code !!! 60 Tage gratis streamen!!!
Qobuz
Qobuz – unser Lieblings-Streaming-Portal wartet mit einer neuen Aktion auf!
Ab sofort streamen Sie über 100 Millionen Titel 60 Tage lang für lau!! Noppes! Sie zahlen nischte! 🙂
Mit diesem Qobuz-Code: 2D7134D1
Und denken Sie daran:
Qobuz ist der Garant für eine gigantische Musikauswahl.
PrimeCore Audio® …ist der Garant dafür, das High-Res-Audio auch klingt wie High-Res-Audio und nicht wie MP3. 🙂 [...]
Weiterlesen...
2) Aktuelle Produktberichte
1) Aktuelle Produktberichte
21. Februar 2024ProduktberichteGalvanische Trennung im Streaming-Heimnetz durch Baaske MI 2005
Wer immer noch „auf Platte macht“ oder CDs hört, der muss sich über das Thema „Galvanische Trennung im Streaming-Heimnetz durch Baaske MI 2005 Netzwerk-Isolatoren“ wahrlich keine Gedanken machen.
Baaske Medical MI 2005
Wissenschaftlich betrachtet wurde die Galvanik im 18. Jahrhundert zufällig durch einen Herrn Galvani entdeckt – was aber für das heutige Thema keine Bedeutung hat.Und nein – ich werde hier auch nicht die im Netz zusammengesuchten Informationen als mein Wissen von mir geben und versuchen, Ihnen die Galvanik zu erklären.Mich interessiert für diesen Bericht nur die galvanische Trennung, bzw. das, was wir als HiFi-Freunde so bezeichnen.
Und dabei geht es darum, etwas zu trennen, was wir eigentlich miteinander verbinden wollen.
Aber wieso will man überhaupt etwas trennen .. und was?
Antwort: Wie so oft geht es mal wieder um Potentiale.
Jeder, der schon mal einen Schukostecker umgedreht hat, um den Klang zu verbessern (ausphasen), der weiß vermutlich, welche negativen Auswirkungen eine falsche Phase und die daraus resultierenden höheren Potentialausgleichsströme zwischen unseren Komponenten auf unsere Musik haben können.Wie soll denn auch ein elektronisches Gerät zwischen elektrischen Musiksignalen und elektrischen Ausgleichsströmen unterscheiden können?Und hierbei sprechen wir bisher „nur“ von Potentialunterschieden zwischen Komponenten, die mit dem selben Stromnetz verbunden sind.
Kommen andere Netze hinzu wie ein Kabelanschluss oder der Telekommunikationsanschluss, können – meistens durch fehlerhaft durchgeführte Anschlüsse – erhebliche Potentialunterschiede vorhanden sein, die sogar unser Leib und Leben gefährden können.
Ich kann mich an abgebrannte Tuner erinnern, bei denen die Besitzer versucht hatten, das Antennenkabel eines Kabelanschlusses bei eingeschaltetem Radio einzustecken.… was dann natürlich das zeitliche Ende dieser Geräte bedeutete.
Ursache: Potentialausgleichsströme.
In professionellen Umfeldern – wie zum Beispiel in Betrieben, in denen Messdaten ermittelt und ausgewertet werden, kann man auf eine galvanischen Trennungen nicht verzichten, weil verschiedene Potentiale die Messergebnisse unbrauchbar werden lassen.
Und im medizinischen Bereich können wir genau so wenig auf eine galvanische Trennung verzichten. Hier wird mit unterschiedlichsten Apparaten hantiert, die einerseits am Stromnetz hängen, andererseits am lokalen Netzwerk (LAN) und darüber dann auch am öffentlichen Netz (WAN) … und die zudem auch noch selber hohe Spannungen erzeugen.
Wer hier als Arzt nicht für die erforderliche galvanische Trennung sorgt, setzt die Gesundheit seiner Patienten leichtfertig aufs Spiel.
Wie immer geht es im HiFi-Bereich zum Glück gar nicht um die gefährlichen Auswirkungen solcher Dinge, sondern einfach nur um einen besseren Klang.
High-Fidelity-Geräte formen Musik aus elektronischen Spannungen. Strom ist hier sozusagen das „Material“, aus dem sie etwas formen wie der Bildhauer etwas aus Ton erschafft.
Potentialausgleichsströme sind „zusätzliches Material“, die uns den Blick auf das Original verwehren. So wie Autohersteller ihre „Erlkönige“ mit Zusatzaufbauten und geometrischen Mustern tarnen, so tarnen diese unerwünschten Potentialströme das Musiksignal.
Das Dilemma: Trennen wir die Komponenten voneinander, fließen auch die Musiksignale nicht mehr. 🙁
Hier kommen wir zur galvanischen Trennung. Mit ihr verbinden wir die Dinge, die zusammen gehören und trennen die Dinge, die nicht zusammen gehören.
Solche galvanischen Trennungen gehören heute fast schon zum Pflichtprogramm der Entwickler hochwertiger Komponenten. Vor allem dann, wenn wir die Geräte auch mit dem Heimnetz verbinden können.
Hier sollte man den Vorteil der oft verschmähten Lösung einer WLAN-Übertragung erkennen:Eine Einhundertprozentige galvanische Trennung!Auch Glasfaserverbindungen erreichen dieses Ergebnis.
Aber nicht immer lässt sich das so regeln und natürlich ist eine Kabelverbindung immer noch stabiler als die drahtlose.Damit wir auch mit LAN-Kabel-Verbindungen zu einer galvanischen Trennung kommen, hat die Deutsche Firma Baaske Medical ihre Netzwerkisolatoren MI 1005 und jetzt neu MI 2005 entwickelt.
Baaske Medical Logo
Nein – natürlich nicht für uns HiFi-Freaks, sondern für medizinische Einrichtungen.
Aber natürlich ist es nicht verboten, sich als Trittbrettfahrer an die Lösung dran zu hängen. 🙂
Der große Vorteil:
Der MI 2005 macht was er soll und kostet deutlich weniger als so manch eine „audiophile Lösung“, die dann auch nichts anderes macht.
Klartext:
Dieser MI 2005 sorgt dafür, dass zwischen dem Heimnetz und unserer Stereoanlage keine elektrische Verbindung hergestellt wird. Die Signale gehen durch – die unerwünschten Potentialausgleichsspannungen nicht.
Baaske Medical MI 2005
Der MI 2005 ist der Nachfolger des im HiFi-Bereich bereits seit längerem beliebten MI 1005 und ist in der Lage, höhere Datenraten zu bewältigen.Höhere Datenraten sind im HiFi-Bereich zwar nicht erwünscht, denn sie gehen in der Regel auch mit höheren Störungen einher, aber natürlich kommt der MI 2005 auch mit 100MBit gut zurecht. 🙂
Das müssen wir bedenken:
Gibt es überhaupt keine unterschiedlichen Potentiale zwischen unserer HiFi-Anlage und unserem Heimnetz – kann auch eine galvanische Trennung nicht den Klang verbessern.Sind aber diese unterschiedlichen Potentiale vorhanden, kann so ein Baaske MI 2005 ein echter Problemlöser sein.
Wir haben jedenfalls sehr gute Erfahrungen damit gemacht und nutzen mehrere Isolatoren in unserem Heimnetz. Ab sofort bieten wir deshalb diese Geräte auch hier in unserem Shop an.
Sie zahlen nur: 131,- €Kunden mit einem Kundenkonto zahlen: 127,07 €Stammkunden zahlen: 124,45 €
Link zum Shop: Baaske MI 2005 – hier klicken
Link zur Produktbeschreibung des Herstellers: https://baaske-medical.de/media/content/downloads/Datenblatt_Netzwerk_Isolator_MI2005.pdf [...]
Lesen Sie weiter ...
25. Januar 2024Produktberichte… und ich mach mein Ding.
Progressive Audio Stromaufbereiter diagonal
Stromaufbereiter von Progressive Audio
In meinem Bericht „Stromaufbereiter von Progressive Audio“ geht es heute um ein Themenfeld, das schon von etlichen Entwicklern mehr oder weniger intensiv beackert wurde.
Aber warum ist dieses Thema eigentlich sooooo wichtig?
Musik ist modulierter Strom
… zumindest bei der Wiedergabe über eine HiFi-Anlage ist das so!
Niemand von uns macht sich über die Stromqualität Gedanken, wenn wir eine Bohrmaschine oder einen Küchenmixer, einen Staubsauger oder was auch immer betreiben. Sie alle nutzen Strom als Energiequelle und die muss genug Kraft liefern, um den Motor antreiben zu können. Mehr Anforderungen stellen wir hier nicht an den Strom.
Das sieht bei einer hochwertigen HiFi-Anlage anders aus. Leider.
Leider – weil sich die Klangqualität analog zur Güte des gelieferten Stroms verändert. … und leider – weil “die Güte des gelieferten Stroms” von mehreren (!) Faktoren abhängig ist.
Strom ist nicht nur “schmutzig”!
Die Hersteller von Filtern und allerlei Zubehör überbieten sich seit etwa 40 Jahren darin, ihren Kunden “schmutzigen Strom” bildlich darzustellen. Auf Messen macht man akustisch deutlich, welche Störgeräusche sich in unserem Stromnetz befinden und verbreiten. Und natürlich – wie wirkungsvoll ihre Produkte diese Störungen beseitigen.
Was sie den Besuchern und ihren Kunden nicht erzählen ist, wie genau sie das anstellen.Und das dies nur ein Kampf an einer von vielen Fronten ist.
Und wer sich so manche Lösung mal genau anschaut, der muss sich schon ein wenig “veräppelt” vorkommen.Das Problem mit den zu kleinen Akkus im Elektroauto könnte man doch auch mit einem Verlängerungskabel beseitigen, oder?Naja.
Wenn Sie in Ihrer Anlage ein fettes Erdungsbrummen hören, müssen Sie einfach nur den Verstärker ausschalten – und das Brummen ist weg. Richtig?!
Zwei Beispiele für ziemlich “blöde” Lösungen, die aber am Ende die Probleme – zumindest theoretisch – beseitigen.
Genau solche “blöden” Lösungen finden wir aber in einer Großzahl an Netzfilter-Leisten.
Im einfachsten Fall werden da nämlich nur einzelne Adern durch einen Ringmagneten gezogen.Dadurch werden hochfrequente Störungen beseitigt oder zumindest gemildert.
Was diese Methode aber ebenfalls bewirkt ist, dass die Obertöne herausgefiltert werden.Hochfrequente Störungen sind hohe Frequenzen – die sind also weg – das ist gut.Hochfrequente Musiksignale sind aber auch hohe Frequenzen – und die sind also auch weg – das ist blöd.Und die für einen guten HiFi-Klang sehr wichtigen Frequenzen sind nun einmal die Obertöne. Also auch wieder (extrem) hohe Frequenzen. Auch sie sind weg, wenn wir einen Netzfilter einsetzen.Erst die Obertöne machen aber doch aus einer Geige eine Stradivari.Erst die Obertöne lassen uns den Unterschied zwischen einem Yamaha, einem Bechstein und einem Steinway erkennen.
Mit einem einfachen Netzfilter in der Kette – wird das schwierig.
Das finde ich blöd!
Genau so blöd finde ich es, dass dem Kunden dann das “verhangene” Klangbild als besonders “analog” verkauft wird. Analog ist nicht “verhangen”.
Leider muss man aber feststellen, dass manche Menschen so viele Störungen in ihrem Netz haben, dass ihnen Musik ohne Obertöne und ohne Störungen dann doch lieber ist als Musik mit Obertönen und mit Störungen.Nun gut, auch ich kenne Situationen vor Ort, in denen man tatsächlich nicht um den Einsatz von Stromfiltern herum kam.Man sollte sich aber davor hüten, Netzfilter wie “Nahrungsergänzungsmittel” und zusätzliche Vitamine einzusetzen, als wäre uns Mitteleuropäern jeglicher Zugang zu gesunder Ernährung verwehrt.
Immer wieder bringe ich Kunden vor Ort ins Grübeln, wenn ich sie bitte, einfach mal die teure Filterleiste gegen eine einfache Verteilerleiste aus dem Baumarkt zu ersetzen. Und plötzlich ist da wieder so etwas wie Lebendigkeit und Spielfreude.Verstehen Sie mich bitte nicht falsch!
Wenn Sie einen Stromfilter einsetzen und es Ihnen damit besser gefällt als ohne, dann lassen Sie sich nicht durch diesen Bericht verrückt machen. Ihre Zufriedenheit ist das wichtigste Ziel. Und wenn Sie die mit Filter besser erreichen als ohne, dann ist das gut so. Nur, ich selber mag einfach keine Filter im Signalweg, die die hohen Frequenzen auslöschen.
Man muss aktiv werden
Um das Problem wirklich an der Wurzel zu packen, muss man genau studieren, was da überhaupt geschieht und dann gezielt vorgehen. Dabei taucht allerdings ganz schnell ein großes Problem auf: Die Lösung wird teuer!
Genau genommen aber – gibt man das Geld sowieso aus!
Beispiel:In den 1980-er Jahren hatte ich ein Paar Monoblöcke von Mark Levinson im Programm. Sie nannten sich No.33 und kosteten etwa 60.000,- DM. Der Deutschland-Vertrieb mochte es, oben aus diesen “Riesentrümmern in Form zweier Ölradiatoren” jeweils eine etwa 15×15 cm große Platine heraus zu ziehen und zu sagen: “Das hier – ist alles, was mit Musik zu tun hat! Alles andere kümmert sich darum, den Strom zu reinigen und zu stabilisieren!”.
Berechnen wir die beiden Platinen mal zusammen mit 10.000,- DM – dann bleiben 50.000,- DM für die Stromaufbereitung.Und soll ich Ihnen was sagen? Auch in dem CD-Spieler und in der Vorstufe wurde ein extrem hoher Aufwand getrieben, um den Strom zu reinigen und zu stabilisieren. Wir Kunden mochten das. 60.000,- DM waren viel Geld. Aber man bekam ja auch riesige Endstufen dafür! Man hat was gesehen für sein Geld!
Progressive Audio zentralisiert die Lösung!
Statt uns lauter sündhaft teure HiFi-Geräte kaufen zu müssen, von denen wir wissen, dass der Hersteller sehr viel Aufwand betreibt, um den Strom zu reinigen, stellt uns Progressive Audio mit seinem Stromaufbereiter nun eine Komponente zur Verfügung, mit der sich diese Hersteller den Aufwand zukünftig genau genommen sparen können.
Aber dieser Stromaufbereiter ist nicht etwa wieder nur ein großer Filter – er ist überhaupt kein Filter!Er packt das Übel an der Wurzel.
Progressive Audio Stromaufbereiter Anschlussfeld
Der Klang einer HiFi-Anlage steht und fällt nun einmal mit der Qualität des Stroms. Und die ist leider in jedem Haushalt anders und noch dazu im Laufe der Wochentage und Tageszeiten oft sehr unterschiedlich. Gestern, am späten Abend hat es noch so wunderbar geklungen – heute Morgen finden wir keine Freude mehr an unserer HiFi-Anlage.
Für uns Musikliebhaber wäre es so wichtig, dass unsere Elektrizitätswerke darauf achten, uns konstant die Stromwerte zu liefern, auf die unsere Komponenten optimiert sind.
Stattdessen wächst die Kritik an der Stromqualität mehr und mehr.Auch und vor allem von denen, die mit guter Musik gar nichts am Hut haben, sondern ein Gewerbe betreiben.
Die Schuldigen sucht man an verschiedenen Fronten.
Windrad
Mehr als allen anderen schiebt man den erneuerbaren Energien die Schuld in die Schuhe. Sie liefern den Strom nicht konstant und nicht zuverlässig. Kein Sonnenschein, kein Wind = kein Strom.
Börse
Mal sollen es die Schichtwechsel bei den Energiewerken sein und ein anderes mal will ein Institut alle 15 Minuten eine Schwankung nachgewiesen haben, was man auf die Börse zurückführt, denn dort wird der Strompreis alle 15 Minuten neu verhandelt.
Am Ende liegt es aber vermutlich auch an viel zu alten Leitungen, die dringend saniert werden müssten.
Hier mal ein Messprotokoll auf der Internet-Seite von Next-Kraftwerke.de.
Frequenzmessung
Wer damit eine hochwertige HiFi-Komponente betreiben wollte, der hätte am Abend des 10. Januar 2019 in Köln-Ehrenfeld wohl besser spazieren gehen können. Was nicht heißen soll, dass der Schrieb an anderen Tagen wirklich besser ausgesehen hat.
Aber unser Stromnetz weist nicht nur Frequenzschwankungen auf, sondern auch solche in der Voltzahl.
Bis zu 10% werden gesetzlich toleriert. Eine Belieferung mit Werten zwischen 207 Volt und 253 Volt sind damit zulässig.
Die Energiekonzerne weisen gerne darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte gefälligst so tolerant gebaut sein müssen, dass sie innerhalb dieser Wertegrenzen keinen Schaden nehmen und verweisen darauf, dass eine konstantere Stromlieferung technisch unmöglich sei.
Wer besseren Strom braucht, muss sich ihn eben selber machen!
Aber was macht jemand – sagen wir mal ein Laborbetreiber – bei dem die Funktion seiner Geräte direkt von konstanten Stromwerten abhängig ist und deren Mess-Ergebnisse durch Stromschwankungen verfälscht werden?Nun, ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf einen eigenen Stromaufbereiter zurück zu greifen.Dieser ist eingangsseitig logischerweise am öffentlichen Stromnetz angeschlossen, ausgangsseitig jedoch liefert er „seinen eigenen Strom“. So ein Stromaufbereiter kann dann aber auch schon mal die Größe eines Kinderzimmers annehmen.
So etwas wollte Ralf Koenen für seinen Entwicklungsraum auch haben!
Nur natürlich kleiner, denn es sollte ja kein mehrstöckiges Labor versorgt werden, sondern nur ein-zwei HiFi-Konstellationen.Zunächst nahm er noch an, er könne einfach aus einem Katalog einen passenden Stromaufbereiter auswählen und ordern. Doch schnell stellte sich heraus, dass ein High-Ender dann doch wieder völlig andere Ansprüche an die Fähigkeiten und Eigenschaften eines solchen Gerätes stellt, als alle anderen.Aber der Bazillus war gesetzt und den Wunsch einfach zu verwerfen, war für Ralf Koenen keine akzeptable Option.
Es führte also an einer eigenen Entwicklung kein Weg mehr vorbei.
Was in der Theorie schnell beschlossen war, hat Ralf Koenen dann mehr als 3 Jahre Entwicklungszeit gekostet.Es war im Frühjahr 2021, als er den ersten Prototypen mit zu mir brachte und ich ihn in meiner Kette hören durfte.
Nun muss man dazu folgendes wissen:Ich lebe in einem Haus am nördlichen Stadtrand von Oberhausen. Ein paar Schritte habe ich zu gehen und befinde mich in einem Wald- und Wiesengebiet, das bis zur holländischen Grenze reicht.
Doepke DFS Audio
Trecker und andere land- und forstwirtschaftliche Geräte gehören zu unserem Straßenbild. Keine Industrie, kein Krankenhaus, kein Sendemast … es gibt nichts, was einen spürbaren Einfluss auf unsere Netzspannung haben könnte.Als Fehlerstromschutzschalter nutze ich einen Doepke Audio-Fi und den Schutz für meine Anlagen übernimmt eine hydraulische Gigawatt-Sicherung.
Es klingt bei mir hervorragend und immer gleich gut. Auch nachts oder am Wochenende klingt es nicht besser und nicht schlechter als mitten in der Woche.
Ich sehe mich, was das Stromnetz angeht, also in einer beneidenswerten Situation.
Entsprechend niedrig hatte ich die Erwartungen an diesen Prototypen geschraubt. Andere mochten ja vielleicht einen Vorteil daraus ziehen, aber hier bei mir …
Nun, Sie lesen diesen Bericht von mir und werden es sich denken können.Es hat nur wenige Minuten gedauert und Ralf Koenen nahm zur Kenntnis, dass er ganz sicher nicht nur eines dieser Geräte zu produzieren haben würde.Das seltsame an der ganzen Sache ist, dass dieses „eigene Stromnetz“ in der Lage ist, Klangprobleme zu beseitigen, die man vorher gar nicht als Klangprobleme erkannt hatte. Zu selbstverständlich waren die Auswirkungen.
Woher sollten wir auch dazu in der Lage sein, so etwas zu erkennen?Ich bin Baujahr 54 und noch nie in meinem Leben habe ich meine Anlage über „mein eigenes Stromnetz“ betrieben! Wenn mal etwas nicht so toll geklungen hat – wie hätte ich das auf das Stromnetz schieben können? Da gab es doch noch ganz andere Faktoren, denen man die Schuld in die Schuhe schieben konnte.Man muss es wirklich mal selber hören, um das zu erkennen.
Hätte man nicht besser eine riesige Batterie oder einen gigantischen Akku verwenden können?
Nun, diese Versuche und Bemühungen gibt es ja längst.Und ja – ein Problem, nämlich das der hochfrequenten Einstreuungen und sonstigen „Sauereien“, die sich so in unserem Stromnetz tummeln – die bekommt man mit Batterien und Akkumulatoren auch sehr gut in den Griff.
Aber schaut man sich die Anforderungen im Spielbetrieb mal mit einem Oszilloskopen an, erkennt man leicht, dass solche reinen Stromspeicher ihren Strom völlig anders abgeben als das bei der Versorgung über das Stromnetz der Fall ist.
Stabilität
Stabil heißt ja stabil und nicht „ungefähr stabil“.
Und zwar selbst dann, wenn fette Endstufen Impulse zu erzeugen haben. Selbst in komplizierten Heimkino-Anlagen mit einer Multi-Amp-Installation heißt beim Stromaufbereiter von Progressive Audio stabil immer auch stabil.Bis zu 3KW kann der “große” Stromaufbereiter liefern, dauerhaft (!) und ebenso als Impuls.(Der “kleine” liefert bis zu 1 KW.) Für stereophone High-End-Anlagen alle male genug.
Zwar ist die originalgetreue Reproduktion von Impulsen die Aufgabe des Verstärkers und Entwickler statten sie deshalb z.B. mit ganzen Gruppen von Kondensatoren aus, um genug Leistung liefern zu können, aber mit dem Stromaufbereiter von Progressive Audio hat man fast den Eindruck, dass wir diese Konstruktionen gar nicht mehr benötigen. Vermutlich wird die Wahrheit sein, dass sich hier zwei Maßnahmen mit dem selben Ziel gegenseitig unterstützen. Klanglich ist das jedenfalls toll!
Dauerleistung
Systeme, die auf Akkumulatoren oder Batterien aufsetzen, leiden manchmal unter der Tatsache, dass sie gerne mal bei Impulsbelastungen „einknicken“ und sich danach erst wieder erholen müssen. Der Stromaufbereiter liefert den erforderlichen Strom, so lange unser Netzbetreiber ihn versorgt.
Impulsleistung
Musik lebt von Impulsen. Aber Impuls ist nicht gleich Impuls.Ein Rimshot (wenn der Schlagzeuger mit seinem Stick auf das Fell und den Rand der Snarr gleichzeitig schlägt, um ein Knallgeräusch zu erzeugen) wird nur dann korrekt wiedergegeben, wenn der Impuls authentisch, also schlagartig, blitzschnell und verzögerungsfrei nach oben schnellen kann – allerdings wird dafür nicht viel „Volumen“ benötigt. Ganz anders sieht das bei einer Basedrum aus. Hier lässt selbst ein harter Kick auf das große Fell einen im Vergleich zum Rimshot eher langsamen Impulsaufbau zu, der dann aber mit sehr viel Kraft (Volumen) ausgeführt werden muss.
Große Streich- oder Blas-Orchester stellen wieder völlig andere Ansprüche an die Impulsfähigkeit einer Anlage. Und damit auch an den benötigten Strom.Aber keine dieser Anforderungen kann von den HiFi-Komponenten zufriedenstellend erfüllt werden, wenn sie nicht auf eine entsprechend flexible und dauerhaft leistungsfähige Stromquelle zurückgreifen können.
Genau das ist der Grund dafür, weshalb es so viele „Stromverbesserer“ auf dem Markt gibt, die zu einem „schöneren“ und „angenehmeren“ Klangbild führen. Die aber gerade bei der Impuls- oder Dauerleistung doch schnell mal versagen und dann ein wenig „müde“ wirken.
Sauberkeit
Keine HiFi-Messe findet heute mehr statt, ohne dass Ihnen irgendein Hersteller lautstark vorführt, wie viele Störungen sich in dem vorhandenen Stromnetz befinden. Rauschen, Knistern, Prasseln, Zirpen bis hin zum Funk- und Radioempfang – unser Strom ist tatsächlich sehr „schmutzig“!
Zwar handelt es sich hierbei nur um einen einzelnen Aspekt, den wir zu betrachten haben, aber er ist vorhanden und er ist wichtig.Diesen Schmutz zu beseitigen, haben sich viele Hersteller mit vielen unterschiedlichen Systemen zur Aufgabe gemacht.
Der Besitzer eines Stromaufbereiters von Progressive Audio kennt dieses Problem nicht (mehr), denn was er ausgangsseitig unserer HiFi-Anlage zur Verfügung stellt, das ist ein komplett autarkes, eigenes Stromnetz. … vollkommen ohne “Schmutz”.
Ohne lange Leitungen, also auch ohne jede Antennen-Eigenschaften.
Gleichstrom im Wechselstrom?
Ja – leider ein weiteres, ärgerliches Problem.Doch wo soll der Gleichstrom (-anteil) herkommen?Nun – den verursachen Sie in der Regel selber – in Ihrem Haushalt.Aber nicht alleine – auch die Nachbarn helfen da mit.
Immer, wenn Sie zum Beispiel ein Elektrogerät “dimmen” können – nehmen wir einen Fön oder einen Mixer – erzeugt dieses Gerät Gleichstromanteile, die ins Stromnetz abgegeben werden.Im einfachsten Fall hören Sie dann den Trafo in Ihrem Verstärker ordentlich brummen.Störend wird es, wenn dadurch die Klangqualität des Verstärkers (oder einer anderen Komponente) in die Knie geht.
Der Stromaufbereiter von Progressive Audio erzeugt den Strom für Ihre HiFi-Anlage selber.Vor Ort – nur für Ihre HiFi-Anlage.
Die Praxis
Vier Anzeigen auf der Frontplatte informieren uns fortlaufend über die Qualität des zur Verfügung gestellten Stroms.
Wir finden je eine Anzeige für:* Volt* Frequenz* Ampere* Watt
Diese beiden ersten Anzeigen, die die Aufgabe hätten, uns Abweichungen vom Sollwert zu signalisieren, stehen in der Praxis auf zwei Nachkommastellen genau immer auf dem gleichen Wert.
So stabil, dass man schon nach wenigen Minuten mutmaßt, die Werte seien von Progressive Audio fest eingestellt worden. 🙂Tatsächlich sind sie aber ein Indiz dafür, wie gut der Stromaufbereiter seine Arbeit verrichtet.Zum Glück gibt es einen Schalter, mit dem man alle Anzeigen ausschalten kann. Das wird vielen gefallen.
Die anderen beiden Anzeigen stehen für die Leistung, die gerade gefordert wird. Diese beiden Werte verändern sich logischerweise permanent.
Für wen ist der Stromaufbereiter von Progressive Audio gedacht?
Wer sich auf dem Markt der „Stromverbesserer“ umschaut, der wird vom Angebot geradezu erschlagen. Von der Verteilerleiste bis zum Filter, von dem galvanischen Trenner bis zur Batterie, von der computergesteuerten Aufbereitung bis hin zum mächtigen Stromtank, von Entstörgliedern, Purifyern, Abstandhaltern und Granulaten bis hin zu zentralen Massepunkten und noch vielen anderen Lösungen … ganz sicher ist da für „jeden Geschmack“ etwas dabei.
Der Stromaufbereiter von Progressive Audio sieht sich als Lösung, die sich nicht auf einzelne Aspekte der Stromverbesserung beschränkt, sondern die alle (!) Fakten berücksichtigt und uns unabhängig von unserem Stromlieferer mit dem versorgt, was wir Musikbegeisterte benötigen.
Stabilen und sauberen Strom. Getrennt vom Rest der Welt.
Für alle Interessenten außerhalb Deutschlands sei darauf hingewiesen, dass sich der Stromaufbereiter ein- und ausgangsseitig auf 110/120 Volt bei 60 Hz umschalten lässt.
Was mich persönlich besonders erfreut:
Mein bevorzugtes Material bei Steckern und Buchsen ist ganz eindeutig Rhodium. Und am liebsten natürlich in Kombination mit NCF (Nano-Crystal-Formula). Jetzt ist es leider so, dass es nicht gut funktioniert, wenn wir Rhodium „hinter“ anderen Materialien einsetzen.
Zur Klarstellung:Erst Rhodium – … – dann Gold = Das funktioniert und beißt sich nicht.Erst Gold – … – dann Rhodium = Das geht gar nicht! Sobald man ein mal auf Gold gewechselt hat, muss man bei Gold bleiben und darf nicht zurück auf Rhodium wechseln!Tipp: Fangen Sie bereits bei der Wandsteckdose mit Rhodium an!
Besitzen wir zum Beispiel eine Verteilerleiste mit goldenen Kontakten und wählen dann für das Kabel zum Verstärker hin rhodinierte Stecker – kann das ganz schön furchtbar klingen. Richtig gruselig.
Wer den Grund dafür nicht kennt und nicht berücksichtigt, muss glauben, Rhodium an sich würde so furchtbar klingen. Er kann diese Vermutung aber selber ganz schnell widerlegen.Nutzt er das Kabel mit den rhodinierten Steckern nämlich vor (!) der “goldenen” Verteilerleiste, wird er sofort eine erstaunliche Klangverbesserung seiner gesamten Anlage feststellen können.
Einmal Rhodium immer Rhodium
In der Regel ist die Klangverbesserung durch rhodinierte Stecker so groß, dass der Wunsch nach mehr Rhodium aufkommt.Und genau dort liegt dann oft das Problem.
Viele „Stromverbesserer“ verwenden leider keine rhodinierten Buchsen.
Ganz egal wie gut sie auch immer ihre Arbeit verrichten – kombiniere ich sie „dahinter“ mit Rhodium, geht das leider viel zu oft „in die Hose“.Genau das ist der Grund, wieso viele dieser Teile für mich persönlich leider nicht relevant sind, selbst wenn sie grundsätzlich gut funktionieren.Der Progressive Audio Stromaufbereiter ist komplett mit rhodinierten Furutech-Buchsen mit NCF ausgestattet. Das ist einfach wunderbar und erleichtert mir die Kombination enorm!
Gibt es etwas zu berücksichtigen?
Ja – das gibt es.Der Stromaufbereiter versorgt uns nicht nur mit Strom, der vom Rest der Welt getrennt ist, sondern er führt auch zu einer vollständigen Trennung von der “Masse”, also der Hauserde.Dies ist auch zwingend so beizubehalten!Was bedeutet:Alles, was mit unserer HiFi-Anlage verbunden ist (alle Komponenten!) müssen über diesen Stromaufbereiter betrieben werden. Kein einziges Cinchkabel, kein HDMI-Kabel und auch kein LAN-Kabel darf eine Verbindung zu einem Gerät herstellen, was mit der Hauserde verbunden ist. Zum Glück gibt es mittlerweile etliche Adapter zur galvanischen Trennung, sodass dies ziemlich einfach zu realisieren ist.Im LAN-Bereich setzen wir z.B. die von der Fa. Baaske (Link) ein. Sie sind preisgünstig und funktionieren sehr gut.
Fazit:
Der Stromaufbereiter von Progressive Audio ist Ihr ganz persönliches Elektrizitätswerk. Er liefert Ihnen den Strom genau so, wie Sie ihn als High-Ender benötigen. Stabil und sauber.Er macht nicht mehr als das, aber auch nicht weniger.
Und hört man das?
Schon immer kenne ich das, dass Kunden zu mir kommen, sich auf meine Couch setzen, Musik hören und staunen. Viele Kunden haben eine solch hochwertige Wiedergabe vorher noch nicht gehört. Eigentlich – gibt es also gar keinen Grund für mich, solche einen Stromaufbereiter einzusetzen. Zumal er groß ist, schwer ist, teuer ist und auch mal ehrlich gesagt – nicht besonders “hübsch” ist.Aber seitdem ich den Progressive Audio Stromaufbereiter einsetze, reagieren sogar Testredakteure mit einem fast erschrocken wirkenden Gesichtsausdruck, wenn Sie diesen “musikalischen Fluss, gepaart mit einer unglaublichen Präzision und dreidimensionalen Darstellung (Zitat eines bekannten Chef-Redakteurs) wahrnehmen.Man hört die Musik und sonst nichts.
Ich gebe das Teil ganz sicher nicht wieder her. 🙂
Preise:
1 kw: 10.000,- €3 kw: 14.000,- € [...]
Lesen Sie weiter ...
13. September 2023PrimeCore Audio / ProduktberichteHörtest PrimeCore Audio® A7
In meinem Bericht „Hörtest PrimeCore Audio® A7“ soll es heute endlich mal nur ums Musikhören gehen.
Viel ist bereits über die Entwicklung der A5 und A7 geschrieben worden.Heute hören wir mal einfach nur Musik.
Ich starte mit:
Sufjan Stevens, John Wayne Gacy jr. vom Album Illinois
Illinoise
Bei diesem Stück geht es um einen der ersten Massenmörder in der Kriminalgeschichte.
Mir jedoch – geht es vor allem um die weibliche Zweitstimme von Shara Nova.Nach der ersten Strophe setzt sie ein und dann findet ein ständiger Wechsel statt zwischen Harmonie (die zweite Stimme singt abweichende Noten) und Unisono (die zweite Stimme singt die selben Noten wie die erste).In den Unisono-Passagen konnte ich bisher oftmals nur erahnen, dass eine Zweitstimme für einen schöneren Sound sorgen soll. (Stützstimme) Selbst in den Harmonie-Passagen war Shara Nova viel zu oft kaum wahrzunehmen.
Mit dem PrimeCore Audio® A7 bereitet es mir überhaupt keine Probleme, in beiden Gesangsarten Sharas Stimme zu verfolgen. Das macht so viel Spaß, dass ich mir den Titel mehrfach anhöre.
Das wichtigste dabei:Weder die sanfte Vortragsart Sufjan Stevens, noch die klagende Stimme von Shara Nova ziehen diese Deutlichkeit aus einer übertriebenen Präsenz oder Härte. Wunderbar emotional und ergreifend liefern die Beiden hier ein musikalisches Meisterstück ab. Sufjan Stevens ist ein sehr religiöser Mensch und er erzählt in seinem Song erstaunlich verständnisvoll von diesem Massenmörder als liebevollen, netten Herren von Nebenan und mahnt uns dazu, doch auch mal unter den eigenen Dielen nachzuschauen.
Das alles muss man gar nicht wissen – man muss auch nicht auf den Text achten, um den Inhalt zu erfahren.Die musikalischen Mittel, zu denen Sufjan Stevens greift, reichen vollkommen aus um zu verstehen, was in diesem Song beschrieben wird.
Harry Belafonte, All my Trials, Album Belafonte: At Carnegie Hall
Belafonte
Belafonte – klar! At Carnegie Hall – na sicher!
Wer hat sich nicht zu den besten Analog-Zeiten mit Freunden getroffen, um seine unterschiedlichen Pressungen von diesem Album miteinander zu vergleichen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in unserem Studio zusammengekommen sind, um fünf – wie sich herausstellte – ziemlich unterschiedliche Pressungen gegeneinander zu hören.
Heute kam mir das Bongospiel bei „All my Trials“ in den Sinn. Gerade dabei gab es immer große Abweichungen voneinander. Mal musste man sich ziemlich anstrengen, um sie überhaupt hören zu können. Dann waren sie mal zu weit vorne und bei der nächsten Pressung klangen sie einfach nur dumpf.
Ich starte den Song … und mit dem Einsetzen der kleinen Trommeln, macht mein kleines Herz einen ebenso kleinen Hupfer.
Man hört nicht nur den exakten Standort der Bongos, man hört die Resonanzen innerhalb der Trommelkörper und bekommt Hinweise auf den Aufnahmeraum. Man hört, wie sich diese Trommelgeräusche im Saal ausbreiten.Diese Bongos sind nicht einfach nur “da auf der rechten Seite (vom Hörer aus betrachtet) irgendwie” zu hören, sondern sie haben auch eine lebensechte Größe und Dreidimensionalität.
Oft ist es so, dass sie dann nach dem Einsetzen des Gesangs mehr und mehr in den Hintergrund wandern, so dass man sie nicht mehr bewusst wahrnimmt, wenn man nicht explizit auf sie achtet.
Das ist hier gerade unmöglich.
Immer wieder spielt der Percussionist ein kurzes, trockenes und hohes „Plopp“, was ähnlich klingt, wie wenn man mit dem Finger und den Lippen das Öffnen einer Sektflasche nachmacht. Also irgendwas zwischen einem hohen “Slap” und einem “Muffled Tone”.
Was bisher bei mir immer nur „einer der vielen gespielten Töne“ war, wird plötzlich so deutlich, so “auffallend”, dass ich mich heute für die Reaktion Belafontes interessiere. Ich vermute tatsächlich eine Art Interaktion oder Kommunikation zwischen den beiden Musikern. Fast klingt es so, als wolle der übermütige Trommler Belafonte necken. Ich bekomme aber keine Antwort auf diese Frage. Zu sehr ist Harry Belafonte bereits in diesem bedeutungsvollen Text versunken.
Und obwohl ich über Jahrzehnte hinweg den Vertrieb für Produkte von Simon Yorke (Zarathustra), Eddie Driessen (Pluto Audio) und Jan Alaerts inne hatte, muss ich mich heute fragen, ob ich das schon jemals so deutlich und selbstverständlich gehört habe. … und kann nur mit den Achseln zucken.
Es interessiert mich auch gerade nicht. Ich schließe die Augen und genieße den kompletten Titel. Es ist mir nicht möglich, ihn zu stoppen und zu einem anderen Song zu wechseln.
Kyle Eastwood, „Eastwood Overture“, vom Album Symphonic
Kyle Eastwood
Wer sich bei diesem Titel die aufgeführten Komponisten anschaut (John Williams, Ennio Morricone, Clint Eastwood, Kyle Eastwood und Michael Stevens), der sollte wohl schon allein beim Namen John Williams vorgewarnt sein.
Man weiß ja, dass eine Overture nicht nur ein musikalisches Werk einzuleiten hat. Im Saal muss Ruhe einkehren und alle die eingeschlafen sind, sollen gefälligst aufwachen.Wer nach den ersten 40 Sekunden dieser Overture immer noch nicht wach ist, den weckt wohl auch kein Defibrillator mehr auf.
Drei Dinge beeindrucken mich bei diesem Titel:
Erstens sind es diese – im wahrsten Sinne des Wortes – „gewaltigen“ Orchestereinsätze, die einem durchaus Angst einflössen können. Kennen Sie das, wenn Sie doch eigentlich ganz genau wissen, was gleich kommt, aber dann, wenn es da ist, doch so etwas wie ein „Hauch Panik“ verspüren?
Es gibt kein passenderes Wort dafür als „gewaltig“ mit der Betonung auf Gewalt! „Beeindruckend“ ist zu wenig.Man kennt das ja von John Williams und seinem Boston Pops Orchestra.
Zweitens ist es das, was man „Dynamik“ nennt.Fast über den gesamten Titel hinweg ist man geneigt, abwechselnd leiser und dann wieder lauter machen zu wollen.
Man sitzt da und fragt sich, wieso man das tun muss. Das war doch vorher nicht so. Natürlich gab es immer schon in allen möglichen Titeln leise und laute Passagen – aber nach der Fernbedienung oder dem iPAD hat man doch nie greifen wollen, oder?
Braucht man heute natürlich immer noch nicht – sobald man begriffen hat, dass es so sein muss wie es ist.Vorausgesetzt, man nutzt ein Equipment, was in der Lage ist, diesen Dynamikumfang auch zu reproduzieren.
Die Quelle – ist mit einem PrimeCore Audio® jetzt jedenfalls ganz bestimmt nicht mehr das limitierende Glied.
Drittens ist es das, was man „natürliche“ oder eben “korrekte” Darstellung eines großen Orchesters nennen muss. Bei der Aufnahme wurde das Quintett um den Sohn von Clint Eastwood vom Czech National Symphonic Orchestra unter der Leitung des Grammy-prämierten Dirigenten Gast Waltzing unterstützt. Und dieses Orchester steht den Boston Pops um nichts nach.
Allerdings handelt es sich bei der Titelauswahl des Albums nicht um eine einzelne Aufnahme, sondern um ein ganzes Projekt. Kyle Eastwood will diese Musik mit vielen verschiedenen Orchestern live aufführen, um so viele Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln wie nur möglich.Die meisten Konzerte haben bereits stattgefunden aber mit ein wenig Glück kann man noch Karten für die letzten 5 Konzerte (in Frankreich und Lichtenstein) ergattern.
Wer nun also genau weiß, wie so ein Orchester klassischer Weise aufgebaut und positioniert ist, der hat große Freude daran, bei diesem Titel die Augen zu schließen und sich in den Konzertsaal hinein zu „beamen“ und die Positionen der einzelnen Instrumentengruppen zu “kontrollieren”. Gänsehaut pur ist angesagt!
Ich hatte mir für meine Hör-Session die aktive Extreme I von Progressive Audio gewählt. Das erscheint einem bei diesem Titel vielleicht so, als wolle man in der Nordsee mit einem Teelöffel hohe Wellen erzeugen. Um so beeindruckender war es für mich zu hören, wie sehr es doch mit diesen kleinen Schallwandlern zu einem musikalischen Erlebnis wurde, gerade diesen Titel zu hören.
Wir sind weit weg vom „normalen Musik-Hören!“ – was wir hier wahrnehmen, das sind Erlebnisse. Beeindruckende Erlebnisse.
„Ein haben wir noch!?“
Ok – einen Titel häng ich noch dran.
Child in Time, Deep Purple vom Album Deep Purple in Rock
Deep Purple
Wann haben Sie diesen Song das letzte Mal gehört? Die jüngeren Leser müsste ich vermutlich fragen, ob sie diesen legendären Titel überhaupt schon einmal gehört haben. Schließlich wurde das Album bereits 1970 in seiner bekannten Studioversion veröffentlicht.Allerdings wird dieser Titel in allen möglichen Listen der besten Rock-Songs aller Zeiten wohl für immer und ewig unter den ersten 10 zu finden sein. Also sollte man ihn kennen.Wenn nicht – nachholen!
Ich will mich hier aber gar nicht mit irgendwelchen angelesenen Weisheiten wichtig tun, sondern mir geht es heute um den Schlagzeuger Ian Paice.
Natürlich ist er bei diesem Titel omnipräsent. Ob es um sein geniales Beckenspiel während des Intros geht oder um die Tatsache, wie sehr er das ansteigende Tempo während des „Duells zwischen Orgel und Gitarre“ forciert.
Haben Sie schon mal bewusst darauf geachtet, wo Sie sein Schlagzeugspiel orten können?
Steht seine Schießbude links, rechts oder mehr in der Mitte?Können Sie das beantworten?Nun – konnte ich bis gerade eben auch nicht.Dieser Song gehört nicht zum Repertoire „audiophiler Songs“, also höre ich ihn aus Nostalgie-Gründen – fertig. Und niemals zuvor habe ich mir überhaupt die Frage gestellt, die mir jetzt geradezu aufgezwungen wird:
Spielen hier etwa drei Schlagzeuger?
Eingeweihte wissen, dass Ian Paice Linkshänder ist. (Er ist übrigens gerade wieder auf Tour). Wer also weiß, wie man so eine „Bude“ klassisch aufbaut, der muss sich über die ungewöhnliche Positionierung der Toms und Becken bei Paice nicht wundern.
Hier mal ein Foto von der Paiste-Seite. (Paisti gesprochen).
Dieser Aufbau stammt aus dem Jahr 2002 und dürfte dem aus dem Jahre 1970 lediglich ähneln.
Bezeichnend ist die Position der Hi-Hat. Die Hi-Hat wird mit dem Fuß gespielt und kann im Gegensatz zur klassischen Charlston-Maschine oder Low-Hat auch mit den Sticks bespielt werden. Üblicherweise wird sie mit dem linken Fuß gespielt, Ian benutzt den rechten Fuß.… hat die Hi-Hat aber sehr nah am Körper. Man kann also sagen, dass Ian Paice etwa dort sitzt, wo man seine Hi-Hat orten kann.
Und jetzt hören wir uns den Titel einfach mal an.
Während des Intros hört man die Crash- und die Ridebecken eindeutig leicht rechts neben dem linken Lautsprecher. Zwei, drei Becken sind auch bis zur Mitte zwischen den Boxen verteilt.
Nachdem der Gesang einsetzt, hört man dann auch erwartungsgemäß halblinks die Hi-Hat.Zweifelsfrei sitzt Ian Paice also dort auf der linken Seite – von uns aus betrachtet.
Sobald aber der Songteil A beginnt (etwa bei 01:50) , ist im Bereich des linken Lautsprechers nichts mehr vom Schlagzeug zu hören – nicht einmal ein einziges Becken!
Die gesamte Schießbude (inklusive der Hi-Hat!!) ist jetzt leicht links neben dem rechten (!) Lautsprecher positioniert und deutlich weiter hinten als während des Intros.
Dafür aber spielt zunächst fast alles stumpf „übereinander“. Das heißt – ob Toms, Becken oder Hi-Hat, alles scheint vom gleichen Punkt (!!) zu kommen. Das löst sich dann langsam und das Schlagzeug wird immer weiter auseinander gezogen. Bleibt aber immer im Bereich zwischen der rechten Box und der Mitte.
Kurioser Weise wird der Standort des Schlagzeugs dann im Teil B (etwa bei 3:20) erneut gewechselt. Nun befindet er sich exakt mittig zwischen den Boxen.… um dann mit dem zweiten Intro wieder ganz nach links zu wechseln.
Es ist sicherlich nicht so, dass man das mit anderen Anlagen nicht wahrnehmen würde. Man muss ja einfach nur hinhören. Was mich heute aber so beeindruckt ist die Tatsache, dass ich ja eigentlich nur aus Spaß mal wieder einen Titel aus meiner Sturm und Drang-Periode hören wollte und dann feststelle, dass ich auf solche seltsamen Eigenarten förmlich hingewiesen werde. Als würde mich der A7 anschubsen und sagen: „Hör mal! Hast Du gewusst, dass …?“.
Und am Ende des Abends sitze ich vor meiner Anlage und ich frage mich, mit welcher Komponente, analog, digital, CD-Player, Plattenspieler, Streamer … … ich das in dieser Konsequenz schon einmal erlebt habe, was ich heute hören durfte.Und mir fällt keine ein.
Und eine These ist wahr geworden!
Tauscht endlich diese „blöden Computerteile” aus – … die ja angeblich „nur Computerteile“ sind! Sucht nach den Besten und verwendet nur die Besten …… und sie werden klingen wie die Besten!
Genau so ist es!Und wer mir das nicht glaubt, der soll zu mir kommen und sich das bei mir anhören.
Die Einladung steht! [...]
Lesen Sie weiter ...
20. Juli 2023ProduktberichteIdeon Master Time Black Star
Ideon Master Time Black Star
In meinem Bericht „Master Time Black Star“ gehe ich heute der Frage nach, was man von einem Re-Clocker für 3.480,- € erwarten darf.
Folgen wir den Profis
Die Profis sind uns High-Endern fast immer einen gehörigen Schritt voraus. Sie benutzen seit Jahren Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie irgendwann einmal brauchen werden.
Was ja auch einleuchtend ist.
Sie verrichten täglich ihren Job in ihren Tonstudios und wenn das Ergebnis nicht gut genug ist, dann haben sie es mit einem unzufriedenen Kunden zu tun. Und ein unzufriedener Kunde kommt nicht wieder. Also muss man unbedingt dafür sorgen, dass er zufrieden ist.
Im Bezug auf mein heutiges Thema muss man erkennen, dass solche Clock-Geräte zur Ausstattung von Tonstudios gehören, solange es digitale Musik gibt. Das sind mehr 40 Jahre!
In der High-End-Welt sind sie aber noch lange nicht wirklich angekommen. Nur hier und da trifft man auf Musikliebhaber, die sich schon eine Weile mit ihnen befassen. Alle anderen beginnen soeben, sich mal ganz vorsichtig dem Thema zu nähern.
Innuos Phönix USB
Wer regelmäßig meine Berichte begleitet, der weiß, dass ich vor ein paar Jahren mit dem Innuos-Phönix Re-Clocker die ersten Schritte in diese Richtung unternommen habe. Diese Komponente konnte mich beim USB 3.0-Anschluss mehr als überzeugen.
Beim USB 2.0-Anschluss ist es mir jedoch nicht gelungen, eine nachvollziehbare Verbesserung zu erzielen, die den hohen Preis wert gewesen wäre.
MUTEC MC3+ USB
Das änderte sich, als ich mich mit dem MUTEC MC3+USB beschäftigte.
Dieses kleine Teil aus der Profi-Liga schaffte das Kunststück, selbst den USB 2.0-Anschluss noch einmal erstaunlich deutlich (!) zu verbessern.
Eine Stunde mit dem MC3+USB Musik gehört – und man kann nie wieder ohne ihn leben.
Das ist so wie Fussball heutzutage in SD-Qualität zu gucken. Man kann nicht glauben, wie verschwommen das wirkt. Damit haben wir jahrelang gut gelebt!
Genau so klingt es, wenn man den MC3+USB wieder aus der Kette entfernt. Verschwommen!
Unmöglich, damit zufrieden zu sein!
Leider kann und will er in keiner Weise verbergen, dass er aus dem Profi-Lager stammt und so ist seine Frontplatte mit allerlei bunten Lichtern überladen, die dem Profi (und zugegeben auch mir) schnell und ausführlich anzeigen, in welchem Zustand sich das Gerät und die Musiksignal-Verbindungen gerade befinden. Da muss man nicht lange herumrätseln – man sieht sofort, wenn und was da gerade nicht in Ordnung ist.
Das ist im Profi-Bereich unabdingbar – im Wohnzimmer akzeptieren viele Musikliebhaber so etwas nicht. Und außerdem brauchen die auch von den theoretischen Nutzungsmöglichkeiten eines MC3+USB nur eine einzige: Das Re-Clocken.
Nun – sagen wir mal zwei.
Wer einen DAC ohne USB-Eingang betreibt, der freut sich natürlich auch darüber, dass der MC3+USB mit vier (!) verschiedenen Buchsen für den Ausgang aufwartet.
Somit handelt es sich bei ihm also gleichzeitig um einen Re-Clocker und einen herausragend gut klingenden „Konverter“.
Beim Ideon Master Time Black Star müssen wir “Fehlanzeige” melden.
Auf all diese Dinge – muss man beim Re-Clocker von Ideon namens „Master Time Black Star“ verzichten.
Es gibt einen (!) USB-Eingang und einen (!) USB-Ausgang – basta!
Der Master Time Black Star kann also nichts umwandeln, nichts verteilen …
er kann „einfach nur“ das Musik-Signal re-clocken.
Dafür hat er aber auch eine extrem aufgeräumte Front. 🙂
Nun gut – Tatsache ist, dass der Master Time Black Star fast drei mal so viel kostet wie ein MUTEC MC+USB. Kann er die Berechtigung für diesen Preisaufschlag klanglich belegen?
Der Innuos kann es beim USB 2.0-Anschluss jedenfalls nicht. Bei USB 3.0 zieht er dann aber am MC3+USB knapp vorbei.
Und noch ein Argument spricht hier für den Innuos:
Während der MC3+USB intern mit einem recht einfachen Schaltnetzteil aufwartet (weshalb viele handwerklich geschickte User den MC3-USB fix umbauen und ihm eine DC-Buchse verpassen), wartet der Innuos bereits mit einer vorbildlichen audiophilen, linearen Stromversorgung auf.
Hier dürfte wohl der größte Teil des preislichen Aufschlags (zurecht) hinein fließen.
Und wie schlägt sich nun der Master Time Black Star?
Der Master Time Black Star ist seit drei Tagen am Netz und hin und wieder durfte er auch schon im Hintergrund musizieren. Allein schon sein enormes Gewicht verrät uns denn auch auf Anhieb, dass in ihm ein ganz hervorragendes Linearnetzteil werkeln sollte. Vermutlich ist es mit dem des Ayazi MK II identisch.
Butter bei die Fische – wie klingt er?
Ohne Zweifel werde ich mich persönlich von diesem Re-Clocker in Zukunft nicht so schnell wieder trennen können. In keiner einzigen Beziehung hinkt er hinter dem MUTEC hinterher. Sowohl an USB 3.0 als auch an USB 2.0 weiß der Master Time Black Star sichklar an die Spitze zu schieben.
Und zwar nicht nur so ein klein wenig – sondern entscheidend. Auch der Innuos kann sich im direkten Vergleich nicht durchsetzen.
Der klangliche Zugewinn ist so groß, dass aus der anfänglichen Frage:
Wie sinnvoll kann denn bitte ein Re-Clocker für 3.480 € sein?
… jetzt die Frage wird:
Was wird denn wohl passieren, wenn man den „Absolute Time“ für 7.900,- € oder gar den „Absolute Time Signature“ für 18.900,- € anschließt?
Was kann denn da passieren, was noch einmal eine solche Ausgabe rechtfertigen könnte?
Nun, im Moment weiß ich es nicht. Aber je länger ich mir den Master Time Black Star anhöre, umso sicherer werde ich mir, dass da wohl ganz sicher noch „was kommen wird“.
Das Grinsen ist wieder da.
Bereits beim Ayazi MK II war mir aufgefallen – und genau so hatte ich es auch niedergeschrieben – dass mir der Ayazi ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht zauberte.
Meine Güte – wie viele Geräte kenne ich, die versuchen besonders „schön“ zu klingen, besonders warm, analog, weich, musikalisch, harmonisch … –
und immer wieder entlarvt man diesen „Lenor-Sound“ schnell als künstlich erzeugt, auf Kosten der Dynamik, der Lebendigkeit, der Spielfreude. Und am Ende fühlt man sich „eingelullt“ und erkennt, dass die Musik auf diese Art und Weise nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Es ist, als würde man die berühmte rosarote Brille aufsetzen und für immer aufbehalten.
Und genau dieser Verdacht kommt sofort – sowohl beim Ayazi als auch jetzt beim Master Time Black Star auf – aber er bestätigt sich in keiner Weise.
Da lullt nichts ein, da ist nichts „schöner“ als es sein darf, da ist auch nichts verhangen.
Aber da gibt es auch keinesfalls das Gegenteil!
Hier klingt nichts zu hart, nichts zu analytisch, nichts übertrieben dynamisch – nichts davon!
Der Master Time Black Star sorgt dafür, dass die Musik endlich „durchkommt“, ohne manipuliert und eingeschränkt zu werden. Wie soll ich es Ihnen erklären, dass der Ideon die Musik authentisch reproduziert und die dann aber doch mehr Spaß macht als ohne ihn?
Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich Ihnen das erklären soll.
Kommen wir deshalb lieber gleich zu meinen … Klangbeispielen:
Princezito „Lua“ vom Album „Spiga“
Das Stück beginnt mit einer akustischen Gitarre. Man kann sie in allen drei Dimensionen orten und fokussieren. Mit dem Master Time Black Star gewinnt sie an Wertigkeit. Man ist davon überzeugt, ein wirklich teures und edles Instrument zu hören.
Die Stimme von Carlos Alberto Sousa Mendes setzt dann fast unerwartet ein und ist extrem präsent. Authentisch berichtet er über seine Heimat, die Kapverden.
Spätestens bei 1:22 hört man klar und deutlich den Hall, der sich im Aufnahmeraum nach hinten ausdehnt.
Obwohl Princezito auf Konzerten meistens nur singt und seine Band dabei hat, bin ich mir bei dieser Aufnahme fast sicher, dass er selber die Gitarre spielt.
Das ändert sich, wenn bei Minute 1:55 im linken Kanal eine zweite Gitarre hinzu kommt und die erste plötzlich nach rechts wandert? Die Stimme Princezitos aber bleibt genau dort, wo sie von Anfang an gewesen ist. Ganz leicht nach links aus der Mitte heraus.
Und bei Minute 3:00 kommt noch eine dritte Gitarre hinzu. Die spielt wieder mittig. Und so kann es ja doch so sein, dass Princezito zu Anfang das Gitarrenspiel übernommen hat.
Wie dem auch sei – diese Scheibe macht mir gerade richtig-richtig Spaß.
dal:um „Dot“ vom Album Dot
Jetzt wollte ich doch herausfinden, wie „schnell“ der Master Time Black Star sein kann.
Das weibliche Duo mit Ha Suyean (spielt die Gayageum) und Hwang Hyeyoung (spielt die Geomungo), schafft mit diesen aus Korea stammenden „Brettzittern“ eine Akustik, die man wohl mit atemberaubend beschreiben muss. Da knallen Seiten auf den Holzkörper und explodieren Töne aus dem Nichts heraus. Der Ideon leistet sich hier keinerlei Blöße und zaubert eine Lebendigkeit, Dynamik und Authentizität, die beeindruckt.
Schade nur, dass die beiden Instrumente ziemlich überlagernd mittig aufgenommen wurden. Hier wäre eine stärkere Trennung in rechts-links deutlich spannender gewesen. Dennoch – ein faszinierendes Stück Musik – genau so muss es sein.
Tristan Hambleton/Guy Johnston/Mohammed Gad, „Sanctus“, The Armed Man: A Mass für Peace (Karl Jenkins)
Große Chöre, viele Chorgruppen und ein großes Orchester…
die Messe für den Frieden ist kein Stück für einen einsamen Musiker.
Ich hatte das Glück, sie live in einer großen Kirche hören zu dürfen. Und obwohl ich im wahrsten Sinne des Wortes „in der ersten Reihe“ saß, konnte ich miterleben, wie schwer es uns damals fiel, Dinge wie Ortbarkeit und Fokussierbarkeit positiv zu bewerten.
„Das kriege ich zuhause besser hin.“ – denkt man sich dann, aber natürlich ist das nicht der Fall.
Einzelne Instrumente oder Stimmen akustisch so anzuordnen, dass man sie mit der Stecknadelspitze dreidimensional im Raum „anpieksen“ könnte, scheint der Technik und den Tonmeistern heutzutage keine Probleme mehr zu bereiten.
Ganz anders – sieht die Aufgabenstellung hier bei „The armed man“ aus.
Insgesamt fünf große Chorgruppen hatten sich damals im Hintergrund aufgebaut und davor das beeindruckend „bemannte“ (und „befraute“) Orchester.
Irgendwann hörte man auf, darauf zu achten, welches Instrument und welche Stimmengruppe jetzt „von wo“ zu hören war und genoss stattdessen das „Ganze“.
Und auch wenn es den Tonmeistern hier sehr gut gelungen ist, die Darbietung akustisch einzufangen, muss man leider erkennen, dass sie dabei wohl die selben Probleme hatten, wie die, die es live erlebt haben.
Wenn die Posaunengruppe hinten rechts gruppiert ist, man aber den Widerhall von der linken Seite fast in gleicher Lautstärke wahrnehmen kann, muss man einfach die Aufteilung der Instrumente kennen, um Quelle und Hall voneinander unterscheiden zu können.
Und auch zuhause tut man gut daran, das Stück einfach als Ganzes auf sich wirken zu lassen.
Eine Kirche oder ein großer Konzertsaal sind nicht immer etwas für Ortbarkeits-Fanatiker.
Ich habe denn dieses Stück auch genau deshalb ausgesucht, um heraus zu finden, ob der Ideon hier irgendwas dazu tut, weglässt, verändert oder nicht darstellen kann.
Und das Ergebnis ist wie erwartet ein beeindruckend echtes Klangerlebnis.
Hut ab!
Fazit:
Sie mögen noch nicht erkannt haben, dass Sie dringend einen Re-Clocker benötigen und wenn es so weit ist, wird ganz sicher der Geldbeutel ein Wörtchen bei der Auswahl mitzureden haben, aber wenn das Budget reicht – dann kann ich Ihnen den Ideon Master Time Black Star nur wärmstens ans Herz legen. Einen Re-Clocker, der seine Arbeit besser verrichtet als dieses Teil, habe ich bisher noch nicht gehört.
Vielleicht ändert das sich ja bald, denn mit dem Absolute Time und dem Absolute Time Signature hat dieser Hersteller noch zwei schwergewichtige Argumente parat, sich den Master Time Black Star vielleicht doch zu sparen und gleich „Nägel mit Köpfen“ zu machen. 🙂
Vorerst jedoch drängt es mich nicht wirklich dazu, die Komponenten zu testen. Dafür macht mir der Master Time Black Star einfach viel zu viel Spaß.
Wem also der MUTEC MC3+USB zu „professionell“ daher kommt, wer keine „Lichtorgel“ im Wohnzimmer mag oder wer einfach gerne alles von Anfang an „gleich richtig machen“ will, dem sei der Ideon Master Time Black Star empfohlen.
Jetzt einen Ideon Master Time Black Star bestellen. [...]
Lesen Sie weiter ...
15. Februar 2023ProduktberichteProgressive Audio Pearl Diamant V2023
Endlich habe ich es getan! Ich habe mir eine Progressive Audio Pearl Diamant Version 2023 zum Verkaufspreis von 42.700,- € gegönnt. Lesen Sie hier, wieso es nur dieser Lautsprecher werden konnte und kein anderer.
Zum Glück hat Accuton von Hause aus für einen Schutz der wertvollen Chassis gesorgt.
.
Man hat uns beigebracht zu vergleichen.
Redaktionen wie „Stiftung Warentest“ haben uns gelehrt, Dinge zu vergleichen. Das ist gut. Aber eine Sache finde ich dabei manchmal seltsam. Wir begründen Entscheidungen nicht mit den Fakten, die für etwas sprechen, sondern lieber mit Argumenten, die gegen die anderen Alternativen sprechen.
„Wir fahren in die Berge – den ganzen Tag am Strand zu liegen, finden wir langweilig.“
Und mir ist aufgefallen, dass auch ich in vielen Entscheidungsphasen gerne diese Methode anwende.
„Jene Box mag ich aus diesem Grund nicht, die andere kann ich bei mir nicht stellen. Die da sind zu groß, die zu klein, die machen nicht genug Bass, die machen viel zu viel Bass, klingen verhangen, haben nervige Höhen …“
Für meinem Bericht über die Progressive Audio Pearl Diamant in der Version 2023 habe ich mir deshalb heute fest vorgenommen, nichts über andere Lautsprecher zu schreiben, sondern ausschließlich über die Pearl und über die Gründe, die für (!) diesen Ausnahmelautsprecher sprechen.Auch wenn ich weiß, dass das nicht einfach werden wird.
… oder wird es doch einfach?Schau´n wir mal! 🙂
.
Klang – Faszination
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:Sie sitzen vor einer Stereoanlage. Rechts und links vor Ihnen stehen zwei Lautsprecher, die ganz offensichtlich nicht zu der Gattung „klein und billig“ gehören. So eben, wie die Pearl Diamant von Progressive Audio.
Accuton Diamant, Bildrechte: Thiel & Partner
Sie sind zwar nur 1,10m hoch, aber sie strahlen dennoch unmissverständlich eine fast schon dekadente Wertigkeit aus und lassen jeden Betrachter unweigerlich einen ziemlich hohen Preis vermuten.
Also stellen Sie sich darauf ein, dass Sie gleich „ordentlich was auf die Ohren“ bekommen werden. Denn ein Lautsprecher zu diesem Preis, der muss ja mächtig laut spielen können und uns mit seinem Bass die Magenkuhle massieren.
Dann jedoch beginnt jemand mit einem filigranen Gitarrenspiel. Und natürlich werden Sie denken:
„Wie jetzt? Gitarre!? Ich sitze hier gerade vor Boxen, die mehr als 40.000,- € kosten und dann soll ich mir darüber eine Gitarre anhören?“.
Das empfinden Sie als pure Verschwendung! So, als dürften Sie mit einem Ferrari eine Runde drehen …und stünden dann mit ihm im Stau.Wer positiv denkt, genießt es, wenigstens im Ferrari sitzen zu dürfen, genau so, wie mit einer Pearl eine Gitarre hören zu dürfen.Und wenn Sie sich darauf einlassen, merken Sie sogar, dass dieses Gitarrenspiel gar nicht aus den Lautsprechern kommt.Ohne großartig herumrätseln zu müssen, können Sie den “tatsächlichen” Ort des Geschehens genau beschreiben:
Der Gitarrist sitzt (!) etwa 2m hinter den Lautsprechern, genau zwischen dem linken Lautsprecher und der Mitte zwischen den Boxen, also „halblinks“. Er sitzt, weil die Gitarre eben so etwa in 60-70 cm Höhe gehalten wird. Es ist eine akustische Gitarre und es sind Nylon-Saiten aufgezogen.
Kurze Zeit darauf „erzählt“ der Gitarrist Ihnen eine kleine Geschichte. Es ist kein Gesang, mehr so eine Melodie in der Stimme.Die Stimme entsteht im authentischen Abstand von erneut 2m hinter den Lautsprechern und auch in der Höhe nach oben über das Gitarrenspiel versetzt.Jetzt wird es noch deutlicher, dass der Musiker sitzt.Der Mund des Sängers hat die korrekte Größe und Sie hegen nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass dort ein Sänger und Gitarrist Sie gerade angenehm unterhält.
Nur verstehen Sie das nicht so ganz, denn dort, wo der Sänger sitzt, da gibt es keinen Lautsprecher.Die – stehen ja rechts und links neben der Anlage.Die – haben aber gerade mit dem was Sie hören absolut nichts zu tun.
Sie verraten sich nicht einmal dadurch, dass man etwa Zischlaute aus einem der Hochtöner vernehmen könnte. Sie hören auch keine Resonanzgeräusche aus den Bässen, wenn der Gitarrist zwischendurch mal mit den Fingern auf den Gitarrenkörper klopft. Nichts! Wirklich gar nichts – kommt für Sie aus einem dieser beiden Lautsprecher.
Ihnen fällt irgendwann auf, dass da noch andere Musiker mit im Aufnahmeraum sind, die aber noch auf ihren Einsatz warten.Sie können in diesen Raum hineinhören, Sie können die Musiker jetzt bereits „sehen“.Dann gibt der Gitarrist dem Bassisten zu verstehen, dass er einsetzen soll.
Deutlich ist dieses mehr als mannshohe Instrument rechts neben dem Gitarristen, also so ziemlich in der Mitte zu orten. Flink huscht seine linke Hand über die Stege und seine rechte zupft an den langen, dicken Saiten. In einer Art, wie Sie es schon unzählige Male gesehen haben.Unglaublich viele verschiedene Töne und Spielweisen lehren Sie vieles über die klanglichen Fähigkeiten dieses beeindruckenden Instruments. Tiefe, angenehme und füllige Töne erreichen Sie.
Aber immer noch fragen Sie sich, wofür die Lautsprecher da rechts und links stehen, denn aus ihnen kommt immer noch keiner dieser vielen Töne, da sind sind Sie sich ganz sicher.Sie schauen forschend abwechselnd den rechten und den linken Lautsprecher an. Irgendwann muss doch mal irgendein Ton aus diesen Boxen zu hören sein. Aber Fehlanzeige.
Und obwohl Sie geglaubt hatten, dass Bassist und Gitarrist so eng beieinander stehen, dass da niemand mehr dazwischen passen würde, wischt auf einmal ein Schlagzeuger mit einem Stahlbesen über die Snare und die verschiedenen Becken.Genau zwischen den beiden ersten Musikern, nur eben noch einmal etwa 1,5m hinter ihnen.
Dann klappert halb rechts etwas und die darauf folgenden Töne verraten Ihnen, dass das Klappern von einem Saxophon stammt, das sich der Musiker jetzt zum Mund geführt hat.
Eine echt fette Luftsäule wird von diesem Tenor-Saxophon aufgebaut und erfüllt Sie vollständig mit einem warmen und mächtigen Klang. Unweigerlich müssen Sie an ein Schiffshorn denken, aber eben nur, weil Sie das auch immer wieder genau so beeindruckt, wenn Sie es live hören.Und spätestens jetzt steht da der rechte Lautsprecher gefühlt doch ein wenig im Weg.Wieso steht der da überhaupt? Wofür brauchen wir den?Kann man den nicht woanders hinstellen?
Immer noch spielt der Gitarrist sein filigran vorgetragenes Thema und steigert dann plötzlich das Tempo.Der Schlagzeuger wechselt die Besen gegen Holzschlegel und treibt nun seinerseits seine Mitspieler an.
Sie wippen schon längst im Takt und fühlen sich in die Session ein.Als Sie gerade die Augen schließen wollen, knallt der Schlagzeuger zwei aufeinanderfolgende Rimshots auf die Snare, gefolgt von einem kurzen, trockenen, aber umso heftigeren Tritt gegen die Basedrum und einem Schlag auf eine dicke Stand-Tom.Das Schwingen des Fells erreicht Sie mit einer solchen Wucht, dass Sie sich erschrecken und es Ihnen fast unangenehm wird. Sie haben das Gefühl, dass diese Druckwelle Ihren ganzen Körper erfasst hat und sie zweifeln noch daran, ob es Ihr Körper ist, der immer noch nachschwingt, oder ob es nur das Fell der Stand-Tom ist, was Sie immer noch schwingen hören können.
Spätestens jetzt wird Ihnen klar, wieso diese beiden imposanten Lautsprecher da stehen und dass die schon irgendwas mit der Klangerzeugung zu tun haben müssen.Doch immer noch fällt es Ihnen schwer das zu glauben, denn irgendwie passt das, was Sie sehen können nicht zu dem, was Sie hören.
Kurz gesagt, hören Sie mit der Progressive Audio Pearl Diamant keinen Lautsprecher mehr, sondern die Musik.
Und wenn diese zart und filigran gespielt wird, dann macht die Pearl daraus nichts „Großes, Beeindruckendes“, nur um uns zeigen zu wollen, wieso sie so teuer ist, sondern sie spielt es genau so leicht, zart, schnell und filigran wie es der Musiker vorgetragen hat.
Wenn aber in der Musik „etwas Beeindruckendes“ geschieht – ob jetzt ein Fortefortissimo in der Klassik oder einfach ein synthetisches Ereignis im Subton-Bereich, dann schlägt die Pearl fast „erbarmungslos“ zu, füllt unseren Raum mit unglaublichem Schalldruck oder staubtrockenen Impulswellen. Impulswellen, mit denen man gefühlt Nierensteine zertrümmern könnte.
Das ist dann nicht einfach nur mehr „Musik hören“, das ist dann ein akustisches Abenteuer.Aber niemals übertrieben, niemals um seiner selbst Willen, sondern immer nur, um das darzubieten, was sich der Komponist da ausgedacht hat und die Musiker gespielt haben.
Sobald die Musik auf den Pfad der Tugend zurückfindet, zieht sich auch die Pearl wieder zurück und lässt uns von da an nicht einmal mehr ahnen, zu was sie sofort wieder bereit wäre.
Eigentlich ist es doch ganz einfach, einen perfekten Lautsprecher zu beschreiben, oder?
Und die Progressive Audio Pearl Diamant vermittelt mir gerade den Eindruck, dass es auch ganz einfach ist, einen perfekten Lautsprecher zu bauen.
Michelangelo soll mal gesagt haben:Bildhauerei ist gar keine Kunst, denn die fertige Skulptur steckt schon im Stein – man muss bloß alles Überflüssige wegschlagen.
Darauf Bezug nehmend, habe ich bei der Pearl tatsächlich das Gefühl, dass Ralf Koenen hier vor allem das Kunststück fertig gebracht hat, alles weg zu lassen, was einen Lautsprecher nach Lautsprecher klingen lässt. Und übrig geblieben ist die pure Musik.
Liegt es an den Bauteilen?
Ja, ganz sicher.Die in der Pearl verwendeten Chassis aus dem Hause Thiel & Partner (Accuton) gelten derzeit als das Non-Plus-Ultra, weshalb man sie auch noch in Lautsprechern findet, die fast eine halbe Million Euro kosten.Aber genau wie Progressive Audio, verwendet kaum einer der anspruchsvolleren Hersteller die Chassis, ohne sie sich auf die eigenen Bedürfnisse anpassen zu lassen oder es selbst zu tun.Solche individuellen Anpassungen sind teuer, aber ohne sie wären Lautsprecher wie die Progressive Audio Pearl gar nicht denkbar. Denn den Bauteilen auf der einen Seite, stehen die Fähigkeiten des Entwicklers auf der anderen Seite gegenüber. Und erst die Symbiose lässt solche Kunstwerke wie die Pearl Diamant entstehen.
Und so lange Lautsprecher unterschiedlicher Marken, mit der scheinbar selben Bestückung so sehr voneinander abweichende Klangergebnisse erzeugen, wie man das im Falle Accuton leicht selber feststellen kann, kann ich meine Angst davor im Zaume halten, dass irgendwann einmal künstliche Intelligenz unsere Lautsprecher entwickeln wird.
Modellreihe
Die Progressive Audio Pearl gibt es in folgenden Varianten:(TT= Tieftöner, MT = Mittentöner, HT = Hochtöner)
Pearl passiv Keramik 24.750,- €/Paar (Keramik TT, MT und HT)Pearl passiv Diamant 42.700,- €/Paar (Keramik TT und MT, Diamant HT)Pearl aktiv Keramik 34.000,- €/Paar (Keramik TT, MT und HT)Pearl aktiv Diamant 52.000,- €/Paar (Keramik TT und MT, Diamant HT)
Diamant-Hochtöner
Accuton bietet diesen Hochtöner in den Ausführungen 20mm, 25mm, 30mm und 50mm an.Ralf Koenen schwört auf seine modifizierte Ausführung des 30mm-Diamanten, auf den er selbst in der Transformer für 109.000,- € nicht verzichten will.
Bildrechte: Thiel & Partner
Die kleineren Hochton-Modelle würden ihn dazu zwingen, das an das Gesamtkonzept rechnerisch perfekt angepasste 173mm Keramik-Chassis bis in höhere Frequenzbereiche hoch laufen zu lassen. Frequenzbereiche, in denen Keramikchassis an ihre physikalischen Grenzen stoßen, sich Artefakte bilden und sich ein Diamant-Hochtöner deshalb deutlich wohler fühlt.Das 50mm-Modell jedoch führt zu einer Zwickmühle. Lässt man ihm nach unten erweiterte Frequenzbereiche zukommen, findet der Wechsel zwischen Diamant und Keramik in einem Bereich statt, in dem wir diesen Wechsel deutlich wahrnehmen können.Kann man dieser Verlockung widerstehen und verwendet den 50mm-Hochtöner ausschließlich im selben Frequenzbereich wie das 30mm-Chassis, zeigt es einem nur, dass die 2cm mehr Durchmesser auch mehr Material und mehr Gewicht bedeuten und der 50mm HT damit dem 30mm Diamanten deutlich unterlegen ist.
Eine Alternative wäre es an dieser Stelle -theoretisch-, auch den 90mm Diamant-Mittentöner einzusetzen. Damit könnte man das o.g. Problem möglicherweise umgehen.Dies jedoch würde Ralf Koenen unmittelbar dazu zwingen, aus einem Dreiwege-System ein Vierwege-System zu machen, denn der eingesetzte 220mm Tieftöner wäre seinerseits nicht die erste Wahl in den höheren Frequenzbereichen. Man müsste dann also zwischen dem 90mm Diamant und dem 220mm Keramik-Bass noch einen weiteren Mittentöner einsetzen.Das aber will Progressive Audio unbedingt vermeiden.
Bildrechte: Accuton
„Mit keiner anderen Kombination bekommst Du eine solch faszinierende Homogenität hin wie mit dieser Bestückung aus 30mm Diamant-HT, 173mm MT und 220mm TT! Das ist einfach unfassbar, wie diese drei Chassis miteinander harmonieren. Dieser Lautsprecher klingt so sehr „wie aus einem Guss“, dass man überhaupt nicht mehr fragen möchte, warum jemand dieses oder jenes Chassis gewählt hat.“ so Ralf Koenen stolz zu seiner Auswahl.
Was ist nun aber das Besondere an einem Diamant-Hochtöner?
„Einen Diamant-Hochtöner musst Du zu beherrschen lernen wie einen Formel 1 Rennwagen. Der kleinste Fehler – und es endet in einem Fiasko!“ erzählt mir Ralf Koenen. Und das nehme ich ihm gerne ab.
Denn schon mehrmals durfte ich miterleben, wenn Besitzer einer Pearl vom Keramik-Hochtöner auf den Diamanten umgestiegen sind und als erstes fragten:
„Nanu!? Vergessen, den Hochtöner anzuschließen?“ so die übliche Reaktion der Kunden.
Ein selbstbewusstes Lächeln der Progressive Audio-Mannen deutet dann meist unmissverständlich darauf hin, dass man das selbstverständlich nicht (!) vergessen hat.
Wer andere Hochtöner kennt und sich an sie gewöhnt hat, der weiß, dass es unmöglich scheint, zu verheimlichen, dass die hohen und höchsten Töne eben von just einem Hochtöner erzeugt werden. Was ja auch logisch erscheint.
Bis man diesen Diamant-Hochtöner in der Pearl gehört hat.Oder eben nicht gehört hat.
Ist einem das erst einmal bewusst geworden, kann man gar nicht anders, als Musikstücke mit einem ausgeprägten Höhenanteil auszuwählen. Vielleicht Titel, die man sich bisher nicht so gerne anhören mochte. Den Nussknacker zum Beispiel mit den Piccoloflöten.
Der Pearl macht es große Freude, diesen Piccolo- und Querflöten Dreidimensionalität einzuhauchen und ihnen eine wenn auch kleine „Luftsäule“ zu entlocken. Selbst ein Triangel scheint plötzlich so etwas wie einen Klangkörper, einen Resonanzkörper zu besitzen und viel mehr von sich geben zu können als nur „Kling-Kling“.
Wer sich immer schon gefragt hat, was denn wohl den hohen Preis einer teuren Geige ausmachen könnte, der muss sich jetzt einfach mal einen entsprechenden Titel anhören.Auf einmal glauben wir, die Oberfläche dieses teuren Instruments sehen zu können.Und im nächsten Schritt erläutert uns die Pearl Diamant dann auch, was es mit eben genau diesem Holz und diesem Lack auf sich hat und wie wichtig solche Dinge für den ganz besonderen Klang sind.
.
Obertöne hören wir nicht – dafür liegen sie in einem viel zu hohen Bereich.
Fehlen sie aber, weil sie nicht wiedergegeben werden, klingt alles, was wir hören, leider nicht so, wie es in Wirklichkeit klingt.
Ein Sinuston kann nur künstlich erzeugt werden. Es gibt kein akustisches Instrument auf der Welt, was einen reinen Sinuston von sich gibt. Vielmehr besteht jeder Ton eines Instruments aus einem Akkord, einem Zusammenspiel mehrerer Töne mit unterschiedlichen Frequenzen. Frequenzen, die aus einer Hauptfrequenz bestehen und denen sich nach oben wiederholenden (Vielfache) Frequenzen. Das geht bis in den Gigaherzbereich hinein. Und je mehr ein Lautsprecher von den Obertönen erzeugen kann, umso natürlicher und authentischer wird ein Instrument dargestellt.
Sie dürfen aber die Wiedergabe von Obertönen nicht mit der Wiedergabe eines Sinustons verwechseln. Es mag ja sein, dass ein Chassis-Hersteller die physikalische Grenze seines Hochtöners mit 20 oder 30 kHz angibt. Und vielleicht erscheint es Ihnen auch unsinnig, wenn diese Grenze bei einem Diamant-Hochtöner noch höher liegt, wo wir doch selbst im besten Alter Frequenzen von höchstens 20.000 Hz wahrnehmen können.
Aber das alles hat nichts mit der Wiedergabe von Obertönen zu tun, die für sich alleine ja gar nicht da wären, da sie sich eben auf die eigentliche Hauptfrequenz stützen. Selbst Obertöne im Bereich von 200.000 oder 300.000 Hz sind wahrnehmbar. Nur nicht für sich alleine.
Hören Sie sich einfach noch einmal einen Titel an, von dem Sie glauben, Sie würden ihn ganz genau kennen.Und dann hören Sie sich diesen Titel noch einmal über die Progressive Audio Pearl Diamant an.Es könnte gut möglich sein, dass sie hinterher sagen:
„Heute hat das Orchester mal die Übungs-Instrumente zuhause gelassen und mit den „Guten“ gespielt. Meine Güte, was klingt das damit besser!“
Körperwelten
Aber ein Hochtonbereich in dieser Güte führt noch zu einer weiteren Besonderheit.Er teilt Ihnen nicht etwa nur mit, an welcher Stelle (rechts-links, oben-unten, vorne-hinten) ein Instrument gespielt wird, sondern er vermittelt Ihnen auch die Größe des Instruments und wie es gehalten wurde.
Hören wir zum Beispiel einen ganz einfachen Guiro (Ratschgurke), dann erfahren wir nicht nur, wo sich das Instrument bei der Aufnahme befunden hat, sondern auch, ob der Musiker den Guiro „von oben nach unten“ gehalten und gespielt hat, oder ob er mehr auf seinem Unterarm lag und er ihn von vorne nach hinten gestrichen hat.
Und was ist jetzt mit Bass?
Kein anderes Kriterium entscheidet so stark darüber, ob wir einen Lautsprecher für gut befinden, wie sein Bassverhalten.Was er auch in anderen Bereichen veranstalten mag, wenn er uns nicht wenigstens ab und zu mal mit einem fülligen Bass verwöhnt, dann bleibt unsere Geldbörse geschlossen.
Erfahrene HiFi-Betreiber mögen sich ja längst von den übertriebenen Bass-Giganten getrennt haben, die einen doch nur dazu zwingen, bassschluckende Schallelemente einzusetzen, um ihn wenigstens einigermaßen in einen erträglichen Rahmen zu zwingen. Aber wenn in einem Titel Bass vorhanden ist, dann wollen wir ihn auch wahrnehmen können.Was uns dann entweder wieder zum nächsten Bass-Giganten führt oder zu der Erkenntnis, dass wir leider auf einen ordentlichen Tieftonbereich verzichten müssen.
Mit diesem Widerspruch räumt die Pearl komplett auf.
Was wiederum an ihrem Diamant-Hochtöner liegt!!Glauben Sie nicht?Verstehen Sie nicht?Ist aber so!
Lassen Sie mich ihnen schildern, was hier passiert:
Hören Sie sich ein Stück mit Timpani an. Ein Timpano ist die dicke Trommel, die in keinem Orchester fehlen darf. Und jetzt starten wir „Also sprach Zarathustra“, ein Klassik-Titel, den auch die kennen, die keine Klassik mögen.Auf ein Crescendo mit Fortissimo folgen diese berühmten Schläge auf die Timpani.
Bamm-Bomm, Bamm-Bomm … kennen wir alle.
Und jetzt hören Sie mal ganz genau hin.Was, außer diesem Bamm-Bomm, Bamm-Bomm, hören Sie von den Timpani?Sie fragen sich, was Sie denn noch mehr hören sollten?Da kommen wir gleich zu.Denn jetzt hören Sie sich das selbe Stück mit der Pearl Diamant an.
Ich kann Ihnen versichern, dass Sie jetzt deutlich mehr Informationen darüber erhalten werden, was dieser Musiker da tut und um was für Trommeln es sich handelt.
Sie hören, dass er nicht auf die Mitte der Felle schlägt, sondern mehr zum Rand hin. Sie hören, wie das Fell schwingt und wie es ausschwingt. Sie hören, dass sich der Ton nach innen in den Resonanzkörper der Trommel fortsetzt und seinerseits das Fell von innen heraus zum Nachschwingen anregt. Sie hören, dass sich der Ton aber auch nach oben frei in den Raum hinein ausdehnt. Bei jedem Schlag hören Sie nicht nur Holz, sondern Sie hören auch einen Metallanteil, der vom Stimmring stammt.
Fast glauben Sie sehen zu können, dass es sich um rotes Mahagoniholz handelt, aus dem die Timpani gearbeitet wurden. Aber es kann auch sein, dass Sie das nur annehmen, weil die meisten Timpani, die Sie bisher gesehen haben, aus rotem Mahagoniholz waren und Sie gerade durch den authentischen Klang daran erinnert werden.
Und wenn Sie dann auf einmal merken, dass Sie diese beiden Timpani so noch nie über Lautsprecher gehört haben, sondern dass Sie bisher eigentlich immer nur Timpani so gehört haben, wie ein Lautsprecher sie eben mit seinen Membranen wiedergeben kann, dann sind Sie schon ganz genau da, wo ich auch bin. Nämlich bei der Überzeugung, dass Sie das noch nie so „echt“ gehört haben wie mit der Pearl Diamant.
Und die Ursache liegt nicht allein darin, dass dieser Keramik-Tieftöner so artefaktfrei aufzuspielen weiß, sondern vor allem darin, dass der Diamant-Hochtöner mit seinen Obertönen selbst den tiefsten Tönen ihre ureigenen Klangfarben verleiht.Für solch eine Meisterleistung braucht es ein Meister-Chassis und ein kunstvolles Händchen. … Öhrchen. 🙂
Das angenehmste an der Pearl jedoch ist, dass sie zwar jedem Bass folgt – und wenn er noch so rollt oder explodiert. Aber niemals in einer Art, die uns sagen lassen würde: „Der Bass von diesem Lautsprecher klingt toll!“. Niemals!Denn wir hören bei der Pearl „den Bass von diesem Lautsprecher“ – nicht!Die Pearl serviert uns einen Bass so, wie der Musiker ihn erzeugt hat. Rollend, pulsierend, trocken, untermalend, stützend, treibend, fetzig, explodierend …Aber immer hören wir das Instrument und niemals hören wir „den Lautsprecher“.
Warum ich das hier so ausführlich schreibe?
Ganz einfach, weil gerade der Bassbereich so unendlich kritisch und schwierig ist.
Einerseits weiß jeder Hersteller, dass man teure Lautsprecher nur dann verkauft bekommt, wenn die denn laut genug spielen und genug Bass erzeugen.
Andererseits weiß jeder, der sich schon einmal teure Lautsprecher zuhause angehört hat, dass er sich damit monatelange Optimierungsaufgaben ins Haus holt, bei denen es die ganze Zeit hauptsächlich darum geht, den viel zu fetten Bass in den Griff zu bekommen. Also den Bass zu vernichten, den der Lautsprecher zu viel macht und für den wir ja eigentlich sehr viel Geld bezahlt haben. Jetzt aber merken wir Tag für Tag, dass unser Raum diese Menge Bass nicht verkraften kann. Und das Schlimme ist, dass das Problem um so größer wird, je lauter wir Musik hören.Aber gerade dann sollte doch ein teurer Lautsprecher am meisten Spaß machen, oder nicht?
Doch wie laut muss denn ein guter Lautsprecher überhaupt spielen können, um ein “guter” Lautsprecher sein zu dürfen?Muss ein Lautsprecher bei uns zuhause eine Chance haben, sich bei einem „dB Drag Racing“ gegen die Konkurrenz mit 179,5 dB Schalldruck (Rekord) behaupten zu können?
Aber wie laut ist eigentlich “gut”?
Bands rund um den Globus kämpfen um den Titel „Lautestes Rock-Konzert der Welt“ und so weit ich weiß, wird der Rekord mit 139 dB immer noch von „Manowar“ gehalten. P.S.: Die Schmerzgrenze des menschlichen Ohres liegt bei 120 dB.Sagen wir mal so: Des gesunden menschlichen Ohres. 🙂
Wer so etwas zuhause nachstellen will, der sollte sich ganz sicher nicht im HiFi-Bereich nach passendem Equipment umschauen sondern sich eher bei Veranstaltungstechnikern Rat einholen.Von so etwas ist die Pearl weit weit weg. Gott sei Dank.Und ob ein Wacken-Fan also mit der Darbietung der Pearl zuhause rundum glücklich wäre, vermag ich nicht zu beurteilen.Da stoßen einfach unterschiedliche Ansichten aufeinander, die nicht zusammenpassen, weil sie nicht zusammen gehören.Solange Ihnen aber Lautstärken ausreichen, die Ihnen nicht das Trommelfell zerreißen oder unweigerlich zu Hörschäden führen, werden Sie mit dem maximalen Pegel einer Pearl sehr glücklich werden, das kann ich Ihnen versprechen.
Und was ist mit leise?
Genau so interessant dürfte es da für viele sein, wie leise wir mit einer Progressive Audio Pearl denn spielen können, damit es immer noch Spaß macht.Wobei natürlich jeder Techniker hier einlenken wird, dass diese Antwort ja eigentlich vom Verstärker geliefert werden muss.Wenn dem im leisen Bereich „der Saft ausgeht“, kann der Lautsprecher da auch nichts mehr retten.Dennoch –es geht mir vor allem darum, dass die Pearl mit einem geeigneten Verstärker, wie z.B. dem A901 aus gleichem Stall auch dann noch unglaublich viel Spaß machen kann, wenn wir wirklich nur sehr leise hören.
Die Kinder schlafen, die Nachbarn sind empfindlich – es gibt etliche Situationen, in denen wir Rücksicht nehmen müssen. Und in diesen Momenten schlägt die Stunde der Pearl.Mit geradezu erstaunlichem Ergebnis. Auch sehr sehr leise.
Fazit:
Wenn Sie diesen Bericht bis hierher gelesen haben, durften Sie feststellen, dass ich aus meiner positiven Meinung über die Progressive Audio Pearl keine Mördergrube gemacht habe.Der Grund dafür liegt schlicht und ergreifend darin, dass mich dieser Lautsprecher auch nach der langen Zeit der Händlerschaft von 40 Jahren in Staunen versetzt. Und ich behaupten möchte, dass ich es noch nie besser gehört habe. Und das meine ich vollkommen unabhängig vom Preis.
Wer darauf Wert legt, die Musik, jede Stimme und jedes Instrument so zu hören, wie sich das alles in Wirklichkeit zugetragen hat und sich nicht damit zufrieden gibt, dass Töne „irgendwo“ zu hören sind, sondern exakt dreidimensional dort abgebildet werden, wo sie auch bei der Aufnahme entstanden sind und nun scheinbar mit den Boxen überhaupt nichts mehr zu tun haben, der weiß, dass seine Klangansprüche “verdammt hoch sind”. Das dürfen und müssen sie auch sein. Sofern man sich dazu entschließt, sich einen Lautsprecher im Preisbereich einer Progressive Audio Pearl Diamant zuzulegen.
Eine Bitte zum Schluss:
Vielleicht glauben Sie von all dem, was ich hier geschrieben habe, kein Wort. Vielleicht deshalb nicht, weil Sie noch nie einen Lautsprecher gehört haben, der das alles wirklich so wiedergeben konnte, wie ich das hier mit blumigen Worte beschrieben habe.Aber bevor Sie diesen Bericht als reine “Werbung” abtun und sich deshalb wieder mit einer Box zufrieden geben, von der Sie von vornherein wissen, dass sie das alles nicht kann, sollten Sie sich die Progressive Audio Pearl Diamant wenigstens einmal anhören. Versuch macht klug!Und vielleicht habe ich ja doch nicht alles frei erfunden. 😉
Progressive Audio Pearl
Aktiv oder passiv?
Mein Herz schlägt ganz klar für die aktive Version.Dennoch weiß ich, dass viele praktische Gründe gegen sie sprechen können.
Um Ihnen aber die Chance zu geben, Ihren Verstärker an meiner Pearl hören zu können, habe ich mich für die passive Ausführung entschieden.
Sollten Sie gerade auf der Suche nach Ihrem „letzten“ Lautsprecher und dem dazu passenden Verstärker sein, kann ich Ihnen nur zur aktiven Pearl raten. Sie klingt einfach noch einen Tacken überzeugender als die passive Version. Auch wenn man das beim Hören der passiven Pearl für unmöglich hält.
Hier zum Shop wechseln. [...]
Lesen Sie weiter ...
11. Februar 2023ProduktberichteIdeon Ayazi MK 2 Digital-Analog-Wandler (DAC)
In meinem Bericht über den IDEON Ayazi MK 2 Digital-Analog-Wandler (DAC) schreibe ich über einen Digital-Analog-Wandler, für den ich glatt die Empfehlung „Best Buy mit audiophilem Ausrufezeichen“ einführen musste.
Sein Preis: 3.300,- €. Und genau das ist mehr als nur eine kleine Sensation.
Wer suchet der findet,
so steht es schon in der Bibel.
Wie ich zum Ideon Ayazi gefunden habe.
In den letzten Monaten hatten sich zum Thema Digital-Analog-Wandler (DAC) in meinem Studio erstaunliche Dinge zugetragen. Ob es die Hinzunahme der überzeugend klingenden Soulnote-Komponenten war oder das Upgrade im Hause Progressive Audio, immer gingen diese Veränderungen mit großen klanglichen Fortschritten einher.
Aber mit Preisen ab 6.000,- € aufwärts stößt man nicht bei jedem Kunden auf offene Ohren.
Und sich hin zu stellen und zu sagen: „Für weniger Geld bekommt man eben nur Mist!“ – das konnte es ja nicht sein. Das stimmt so ja auch nicht.
Mein Anspruch – mein ganz persönliches Problem:
Höre ich eine Komponente, die vielleicht in ihrer Preisklasse Testsieger werden könnte, die mich aber dennoch nicht überzeugt, dann mag ich sie einfach nicht.
Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn die Beschreibung darauf zielt, dass man sagen will: „Das Ding taugt nichts, aber etwas besseres zu diesem Preis gibt es eben nicht!“, dann ist dieses Produkt für mich einfach überflüssig und erhöht nur unsere Müllberge.
Und ich kaufe sie dann auch nicht ein.
Kunden würden meinen inneren Zwist sofort bemerken. Durch meine Redseligkeit lesen sie in mir wie in einem offenen Buch. Und solche Geräte werde ich nie wieder los – selbst dann nicht, wenn sie anderswo ganz hervorragend umgesetzt werden.
Also ging meine Suche weiter.
Und leider musste ich bisher die Anfragen meiner Kunden im Preisbereich zwischen 1.000,- € und 4.000,- € oft mit einem Achselzucken beantworten.
Gegen den Strom schwimmen?
„Wenn Du Dich traust, gegen den Mainstream zu schwimmen, dann hätten wir da was richtig Feines für Dich. Kommt aus Griechenland.“ hieß es von einem meiner Zulieferer.
„Boh nee! Nicht schon wieder so ein Teil, was keiner kennt und wo man sich den Mund fusselig reden muss, aber am Ende will es dann doch wieder niemand hören. Und schon gar nicht kaufen.
Und dann noch aus Griechenland! Können die noch was anderes als Gyros und Zaziki?“.
Zugegeben – das war gemein und nicht angebracht.
Aber ich denke, Sie können durchaus nachvollziehen, wieso ich bei dieser Information nicht gleich vor lauter Glück Luftsprünge machen wollte, oder?
* Griechenland – kennen Sie gescheite Produkte, die aus Griechenland kommen?
* IDEON – nie gehört.
* Ayazi – kann sich doch keiner merken.
Nein – da lassen wir mal schön die Finger davon.
Dann aber bekam ich Besuch und der hielt mir auf einmal diesen Ayazi entgegen.
Als ich dieses schmale Kästchen mit einer Hand annehmen wollte, zog man es zurück.
„Nimm zwei Hände!“ hörte ich.
Ich nahm zwei Hände und verstand diese Aufforderung, als ich die Komponente in den Händen hielt.
7,2 kg bringt dieses Kästchen auf die Waage. Das ist nichts, was man nicht tragen könnte, aber was angesichts der Gehäusegröße doch schon sehr überraschte.
Den Ayazi ziert eine schlichte Front mit zwei einsamen Kippschaltern. Hinten stoße ich auf funktionalen Purismus.
Kein Toslink, kein AES/EBU – nur USB und SP-DIF/RCA als Eingänge.
Ausgangsseitig – die selbe konsequente Vorgehensweise:
Kein XLR – nur zwei Cinch-Buchsen.
Ich stehe jetzt zwar nicht auf diese Surroundsoundreceiver-Boliden mit über 200 Eingangsbuchsen auf der Rückseite, aber XLR-Anschlüsse hätte ich eigentlich doch schon gerne gehabt.
Aber sagen wir es mal so – wenn der Hersteller denn an der Ausstattung gespart hat, statt an den klangrelevanten Bauteilen, dann sollte mir das am Ende recht sein.
Und außerdem hatte ich ja noch lange nicht den Entschluss gefasst das Teil einzukaufen.
Im Moment erkannte ich auch noch keine Argumente dafür, meine abwehrende Haltung aufgeben zu müssen.
Ich holte also die passenden Kabel und nahm den Ideon Ayazi MK 2 in Betrieb.
Testbeginn
Und eigentlich müsste ich meinen Bericht jetzt hier erst starten.
Alles, was ich bisher an Gedanken zu Ideon und zum Ayazi niedergeschrieben habe, erwies sich im Nachhinein als Ignoranz, Arroganz und war erfüllt von Vorurteilen, die man immer gerne den anderen vorwirft und von denen man sich selber natürlich frei spricht.
Asche auf mein Haupt und eine dicke Entschuldigung in Richtung Griechenland!!!
Ein Blick auf die Internetseite von Ideon Audio (https://ideonaudio.com/ ) zeigt uns schnell, dass diese Firma schon Digital-Analog-Wandler konstruiert hat, als wir noch mit RG58 glaubten, wir hätten das audiophilste Kabel der Welt entdeckt.
Dass wir hier in Deutschland von diesem Hersteller bisher nicht viel gehört haben, könnte man jetzt der Presse vorwerfen. Aber eine Presse spiegelt nur ihre Leserschaft wider und damit liegt der schwarze Peter dann doch wohl wieder bei uns selber.
Ein Blick auf die Preisliste lässt dann auch unseren Mund ein Weilchen offen stehen.
Ein DAC für 41.200,- €, ein Re-Clocker für 18.900,- €?
Mein lieber Scholli!
Aber neben dem Ayazi für vergleichbar „lächerliche“ 3.300,- € steht da auch noch ein Re-Clocker für 360,- € auf der Preisliste. Und zwischen diesen beiden preislichen „Eckpfeilern“ gibt es noch einige weitere interessante Komponenten. Wie kann so etwas zusammenpassen?
Man kennt es ja, dass ein Hersteller eigentlich im unteren oder mittleren Preisbereich zuhause ist, dann aber auch ein utopisch teures Teil im Programm hat, mit dem er den Kunden zeigen will, dass er so etwas auch „drauf hat“.
… drauf hätte, wenn es denn jemand bestellen würde. 🙂
Hier bei Ideon scheint es aber eher umgekehrt zu sein.
Ideon ist doch mehr „da ganz oben“ zuhause und will uns anscheinend mit dem Ayazi zeigen, dass man das „da unten“ auch „drauf hat“. Oder ist das nur mein Eindruck? Ich will es herausfinden.
Der Hörtest
Die ersten Töne erklingen – und irgendwie „trifft mich fast der Schlag“.
Anders kann ich es nicht ausdrücken.
Dieser Schock ist deshalb da, weil ich sofort über folgendes nachdenken muss:
Wenn dies hier „richtig“ klingt, dann klingt alles andere, was ich bisher gehört habe „falsch“. Gleichzeitig aber klingt es hier überhaupt nicht anders als sonst.
Verstehen Sie nicht?
Ich so auch nicht.
Ich versuche es zu erklären.
Es ist doch so:
Seit 1985 führe ich in meinem HiFi-Studio feine und teure Komponenten. Ich kenne die Situation, wenn etwas besser klingt, genau so, wie wenn etwas schlechter klingt.
Ich kenne auch die Situation, wenn etwas einfach nur anders klingt, also mit anderen Worten: einen Sound erzeugt, den man vielleicht eine kurze Zeit ganz toll findet. Der einem aber ziemlich schnell wieder „auf den Keks geht“. Einfach deshalb, weil sich dieser Sound über alles legt und sich auch durch eine andere Verkabelung nicht beseitigen lässt.
Bei diesem Ayazi weiß ich im Moment einfach nicht, was da klanglich genau passiert.
Ich höre Nils Lofgren (war klar, oder?) auf seiner Gitarre spielen und seine Gitarre klingt, wie sie klingen muss. Trotzdem hat sie heute etwas Besonderes. Da ist so ein Klang im Klang, der mich unweigerlich lächeln lässt.
Mussten Sie schon mal bei “Keith don´t go” lächeln? Nach nur fünf Tönen?
Und auf einmal hat Nils Lofgren in seinem Gesang so etwas von Reinhard Mey.
Wissen Sie was ich meine?
Reinhard Mey hat in manchen Liedern wie „Über den Wolken“ so etwas Lyrisches, Poetisches, Melancholisches in seinem Gesang. So etwas Sehnsucht behaftetes. Er sehnt sich nach etwas, ist aber gleichzeitig glücklich mit dem was ist. Melancholie, Hoffnung, Besinnung und eine tiefe Zufriedenheit gleichzeitig, in der man Sehnsucht genießt statt wegen ihr zu leiden.
Solche Lieder hört man nicht, man fühlt sie, man durchlebt sie.
Nils Lofgren hat nichts davon.
Nils Lofgren hatte bisher nichts davon.
Heute muss ich darüber nachdenken.
Dieser Song ist eine Bitte von Nils Lofgren an seinen Haupt-Inspirator Keith Richard, mit den Drogen aufzuhören und sich nicht zu Tode zu fixen.
Natürlich hat das was Dramatisches, Poetisches, aber eben nur im Text, im Sinn – doch Nils Lofgren singt es nicht so.
Als wolle er seinen Schmerz, seine Traurigkeit und seine Hoffnung zwar einerseits der Welt mitteilen, aber andererseits auch nicht so „gefühlsduselig“ daherkommen. Ein Gegensatz also.
Der Ayazi aber entlarvt Lofgrens wahre Seele. Lofgrens weichen Kern.
… oder schönt der Ayazi einfach nur?
Ich habe schon einige Wandler gehört, denen man zu Recht nachsagen konnte, die Absicht zu haben, die Musik besonders „schön“ spielen zu wollen.
Je teurer sie wurden, umso mehr mussten sie anscheinend die Musik „schönen“.
Mit dieser „Lenor-Kategorie“ hat das hier gerade nichts zu tun – überhaupt nichts.
Ein Sound hat in der Regel die Eigenart, sich auf der einen Seite etwas zu gönnen, auf der anderen Seite aber dafür etwas hergeben zu müssen.
Was besonders „schön“ klingt – lässt oft Dynamik und Schnelligkeit vermissen.
Was auffallend „analytisch“ klingt, dem fehlt es meistens an Harmonie.
Es sind diese beiden Schubladen, von denen wir immer wieder reden.
Die Komponenten, die es schaffen, in beiden Schubladen gleichzeitig zu leben, das sind die, die eben leider ein etwas höheres „Honorar“ einfordern als andere. So, als wäre das eben für weniger Geld nicht machbar.
Von dieser These ist hier nichts zu spüren.
Ich höre mir „Wild Streak“ von John Campbell an. Nach etwa 30 Sekunden spielt der Schlagzeuger ein „Rimshot“ – er knallt also den Schlegel auf Fell und Rand der Snare gleichzeitig und erzeugt damit ein schussähnliches Knallgeräusch.
Das kommt hier überzeugend echt und es fehlt nichts an Schnelligkeit, Dynamik, Druck und Härte.
Ich höre mir „Sixteen Tons“ von Geoff Castelucci (Bass) an. Diese Stimme trägt ja an sich schon eine Menge Beeindruckendes in sich. Umso mehr ärgere ich mich immer wieder darüber, wenn Komponenten diese Stimme nicht mit ihrem ganzen Volumen reproduzieren oder sie dick und fett aufquellen lassen.
Die Kunst, die Castelucci vortrefflich beherrscht, liegt ja darin, in einer Stimmlage zu singen, die die meisten Menschen gar nicht erreichen. Das aber mit einer Leichtigkeit, einem Timing und einem Swing, den wir eben sonst nur aus höheren Stimmlagen gewohnt sind.
Castelucci brummelt nicht herum, sondern singt klar und sauber – so muss es auch klingen.
Mit dem Ayazi kommt das so überzeugend herüber, dass man sich irgendwann fragt, wie viel er eigentlich von seinem großen Bruder für über 40.000,- € geerbt hat – und die Antwort kann nur lauten: „Sicherlich eine Menge!“.
Was da für den Aufpreis noch passieren soll, das kann man sich im Umkehrschluss beim besten Willen nicht vorstellen. Werde ich mir aber bestimmt noch anhören.
Hätten wir es hier mit einem DAC in der 8.000,- € bis 10.000,- €-Klasse zu tun, müsste ich ihn jetzt mit anderen Wandlern vergleichen.
Ich höre hier aber gerade einen DAC für 3.300,- €!
… und das kann ich immer noch kaum glauben.
Die Innereien sind laut Datenblatt nichts, was man in dieser Preisklasse nicht erwarten dürfte.
Aber der Ayazi beweist uns mal wieder, dass es bei einem wertvollen Gemälde nicht etwa die aufgetragene Farbe ist, die so teuer war.
Ein wenig Talent und Können vom Maler trägt wohl auch dazu bei. 🙂
Eine Ursache für das souveräne Schauspiel muss man aber wohl nicht lange suchen.
Diese 7,2 kg kommen ja nicht von ungefähr. Hier kann man davon ausgehen, dass im Ayazi ein richtig fetter Trafo von einem Linearnetzteil werkelt und uns beweist, dass Ideon verstanden hat, wie wichtig ein sauberer und stabiler Strom selbst bei Geräten ist, die scheinbar kaum etwas davon verbrauchen.
So etwas macht mir großen Spaß.
Logisch – dass wir die Klangqualität des Ayazi so auch mit der Wahl des Stromkabels entscheidend beeinflussen können. Seien Sie sich also bitte bewusst, dass der Ayazi ein außergewöhnlich gutes Preis-/Leistungsverhältnis besitzt und gönnen Sie ihm deshalb von vornherein ein gutes Stromkabel.
Zweiter Hörtest nach 4 Tagen am Netz.
Zunächst muss ich feststellen, dass sich das Klangbild nicht so stark verändert, wie ich es von anderen Geräten gewohnt bin. Natürlich „reift“ es ein wenig, aber der Ayazi klingt auch “frisch” und “kalt” schon hervorragend.
Den zweiten Hörtest kann ich daher ziemlich einfach zusammenfassen:
Manchmal startet man seine Playlist, hört in jeden Titel ein paar Sekunden hinein und zappt dann zufrieden weiter. Zufrieden deshalb, weil alles gut und richtig geklungen hat. Was will man mehr!?
Mit dem Ayazi fällt es mir jedoch schwer, einen Titel zu verlassen, nur um mir einen anderen anzuhören. Der Ayazi hält mich in der Musik – im Titel.
Ich höre mir jedes Stück länger an als sonst und manche sogar bis zum Ende.
Und wenn ich mich noch so bemühe, klangliche Fehler, Schönfärbereien, Soundelemente oder was auch immer zu finden, was ich diesem Wandler vorwerfen könnte, ich finde nichts davon.
Die Raumabbildung, die Fokussierbarkeit, die Detailverliebtheit, das Timing … was man auch auf die Waagschale legen will – der Ayazi gibt sich keine Blöße.
Fazit:
Der Ideon Ayazi MK 2 versteht es in unglaublicher Art und Weise, uns aus jedem Musikstück das offen zu legen, was man gar nicht hören kann – weil man es nämlich fühlen muss.
Dabei bedient er sich keineswegs der Methode, einen besonders schönen, aber immer gleichen Klang über die Titel zu legen wie ein Bäcker es mit Fondant auf einer Torte tut.
Der Ideon Ayazi MK 2 offenbart uns selbst wechselnde Emotionen und zelebriert jeden Musiktitel in seiner Gänze, mit seinen Klängen und seinen Gefühlen. Er leistet sich dabei keinerlei sachlich-fachlich zu bewertende Klang-Mängel.
Das alles kenne ich – kenne ich gut – aber ganz sicher nicht zu diesem Verkaufspreis.
Zum Produkt im Online-Shop wechseln. [...]
Lesen Sie weiter ...
28. September 2022ProduktberichteSoulnote A-2, D-2 und X-3
Soulnote A-2, D-2 und X-3
In meinem Bericht “Soulnote A-2, D-2 und X-3” möchte ich Ihnen heute mal eine noch recht junge japanische Marke vorstellen und näher bringen.
Soulnote
Es ist ganz sicher kein Makel, wenn Ihnen im Jahr 2022 die japanische Marke SOULNOTE noch nicht bekannt ist. Fataler wäre es allerdings, sie auch weiterhin nicht beachten zu wollen.
Wer mehr über sie erfahren will, den führt ein Klick auf: www.soulnote.audio auf die für Europa eingerichtete Webseite.
Den Bericht über die „Philosophie“ vom kreativen Kopf hinter Soulnote (einem Herrn Kato) finden Sie hier http://www.kcsr.co.jp/eu_sn_philosophy-ge.html sogar in deutscher Sprache zu lesen.
Endlich mal jemand, der offensichtlich den deutschen Markt zu schätzen weiß.
Allerdings brauchen Sie viel Geduld, um sich da durch zu arbeiten, denn es handelt sich um einen Beitrag mit sehr viel Inhalt. Also – schnappen Sie sich ein paar Kekse und eine Tasse Kaffee. Vielleicht auch einen guten Rotwein. 🙂 … und lehnen Sie sich zurück.
Ich kann Ihnen allerdings versprechen, dass sich dieser Zeitaufwand lohnen wird. Die Ideen, Einstellungen und Erklärungen des Herrn Kato sind ziemlich einzigartig, fast schon revolutionär.
… und verraten uns sehr viel über die klanglichen Ziele und wie man sie erreicht hat.
Wenn Sie diesen Artikel genau so verstehen wie ich, wird es Ihnen aber am Ende vermutlich auch genauso ergehen wie mir und Sie werden sich denken:
„Große Töne spucken kann er ja, dieser Herr Kato. Aber steckt da auch etwas dahinter?“
Die Antwort auf diese Frage kann nur ein Hörtest liefern. Und genau das habe ich getan.
Wieso auch Sie sich mit Soulnote befassen sollten
Wie immer im Leben ist es bedeutend einfacher, auf das Albekannte, Altbewährte zu setzen und sich Neuerungen gegenüber zu verschließen. Mehrere Jahrzehnte Marktpräsenz sind immer ein überzeugendes Argument.
… was allerdings in diesem Fall nur ein weiteres Motiv dafür wäre, sich mit den Soulnote-Produkten näher auseinander zu setzen.
Schaut man sich die Personalien genauer an, entdeckt man „Urgesteine“ aus alten Marantz-, NEC- und Philips-Zeiten. … sicher nicht die schlechteste Reputation.
Das wichtigste Argument, sich mit Soulnote zu befassen, ist jedoch:
Die Soulnote-Komponenten spielen auf einem Klangniveau, das für ihre Preisklasse mehr als ungewöhnlich ist. Soulnote hat offensichtlich erkannt, dass man keine Marktanteile gewinnen kann, wenn man sich auf gleichem Klang-Niveau mit den Mitbewerbern in der selben Preisklasse präsentiert.
Ich musste jedenfalls immer mal wieder auf die Gerätebezeichnung schauen, um sicher zu stellen, dass ich die jeweils preisgünstigere Version vor mir hatte und nicht das drei mal teurere Exemplar.
Seelenklang?
Obwohl die Namensgebung einen Klang mit viel „Seele“ suggerieren könnte, den man ja seit Jahrzehnten vor allem den Röhrenverstärkern oder Class A-Komponenten zuspricht, sucht man bei den Soulnote-Geräten einen solchen „Sound“ vergebens.
Der Herr Kato scheint hier mehr darauf zu setzen, dass sich die „musikalische Seele“ schon automatisch zeigen wird, wenn man nur die Töne korrekt reproduziert, statt sie absichtlich „weich zu spülen“. Zum Glück sucht man auch „auf der anderen Klangseite“ vergebens nach einem Sound, der versucht, uns mit einer übertriebenen Analytik für sich zu gewinnen.
Mich überzeugt das sehr und je mehr ich höre, umso stärker spüre ich eine gewisse Seelenverwandschaft mit dieser Marke.
Von daher passt das mit der Namensgebung ja auf einmal doch wieder ganz gut. 🙂
Klappern gehört zum Handwerk?
Woran ich mich definitiv zunächst gewöhnen musste, sind diese „klappernden“ Gehäuse.
Keine Angst – da klappert nichts und vibriert auch nichts beim Musikhören, aber die Verschraubungen z.B. der Deckelplatten werden bei Soulnote bewusst nicht fest angezogen.
Nachdem man vor der Inbetriebnahme alle eingeklemmten Dämmstreifen entfernt hat, stellt man fest, dass einige Gehäuseteile in sich nicht wirklich fest miteinander verbunden sind. Will man ein Gerät anheben, kann das Gehäuse schon mal instabil wirken.
Hinter diesem vermeintlichen „Versäumnis“ steckt eine Philosophie, die man durch kleine Experimente leicht überprüfen können soll.
So liebt Herr Kato diesen Augenblick auf HiFi-Ausstellungen, an dem er seine Geldbörse auf die Deckelplatte seiner Geräte legt. Nicht etwa, weil dann alle staunen, wie prall gefüllt sie ist, sondern einfach deshalb, weil man sofort hören kann, wie sich das Klangbild verändert und die Musik auf einmal „gepresst“ wirkt.
Bei mir im Studio will sich dieser Effekt nicht so wirklich einstellen, aber vielleicht bin ich solchen Dingen gegenüber einfach zu misstrauisch.
Am liebsten würde Soulnote die Geräte ganz ohne Deckelplatte anbieten, aber angesichts der stromführenden Teile im Inneren der Geräte dürfte das aus Sicherheitsgründen wohl keine gute Idee sein.
Mir ist dieser Punkt egal. Es stört nicht und deshalb fällt es mir mittlerweile leicht, diese Besonderheit einfach hinzunehmen.
Wer viel misst misst Mist!?
So lautet eine alte Weisheit und in ihr steckt manchmal sehr viel Wahrheit.
Mit dem Aufkommen der HiFi-Test-Zeitungen in den 1970-er Jahren stützte sich die Presse von Anfang an auf messbare Ergebnisse, statt auf die hörbare Klangqualität.
Damit hatte man dem Leser zumindest schwarz auf weiß etwas zu präsentieren, was irgendwie „unanfechtbar“ zu sein schien.
… was man ja auch nachmessen kann und somit selbst vor Gericht Bestand hätte.
Leider hat sich daraus eine unglückliche Verschiebung der Prioritäten ergeben. Es glauben einem heute viel mehr Leser, wenn grundsätzlich der Mess-Sieger auch zum Testsieger ernannt wird.
Das ist manchmal wirklich schade.
Soulnote ist sich dessen bewusst, gibt aber dennoch dem Klangergebnis den klaren Vortritt, sobald sich bisherige Mess-Weisheiten oder übliche elektronische Methoden, die „in Stein gemeißelt“ zu sein scheinen, als klanglich beschränkend erweisen.
An wichtigen Schlüsselstellen schwimmt Soulnote damit bewusst gegen den Strom und setzt sich der Gefahr aus, skeptisch betrachtet oder von einem oberflächlich arbeitenden Testredakteur schlecht bewertet zu werden.
Natürlich kann auch ich mich da nicht ganz ausklammern, bin mir aber nach meinen Hörtests sicher, dass Soulnote hier in der Szene eher eine inspirierende und ermutigende Rolle spielen wird.
Mag es zwar manchem HiFi-Freak wie ein „Entzug“ vorkommen, wenn er auf einmal aufgefordert wird, selber hinzuhören, statt seine Entscheidung auf messbare Spitzen-Ergebnisse stützen zu können, aber zumindest im „Fall Soulnote“ wird man sich danach tatsächlich wie „entgiftet“ fühlen. 😉
Immer schön im Takt bleiben
Soulnote stattet selbst schon den „kleinen“ DAC D-2 mit einem Anschluss für eine externe Masterclock aus. Und liefert selbstverständlich mit dem X-3 auch gleich eine externe Masterclock im „Corporate Design“ mit. Beim „großen“ DAC D-3 setzt man sogar vollends auf die externe Clock, ohne – läuft bei ihm gar nichts.
Dies allein könnte Soulnote schnell einen klaren Marktvorteil verschaffen.
Bei der Suche nach einem DAC mit Clock-Anschluss reicht heute wohl die Hand eines Dreifinger-Faultiers, um den Markt vollständig zu beschreiben.
Und das in einer Zeit, in der die Masterclocks, ob nun von MUTEC, SotM oder jetzt auch Soulnote in Mode kommen.
Als begeisterter Betreiber einer MUTEC REF10 SE120 Masterclock war für mich vor allem der Klangvergleich zwischen dem MUTEC und dem X-3 höchst spannend.
Um ein Ergebnis vorweg zu nehmen:
Mit den Masterclocks kommt es tatsächlich zu unterschiedlichen Klangergebnissen. Dazu später mehr.
Man sollte nur wissen:
Während der MUTEC REF10 SE120 mit insgesamt 10 Ausgängen aufwartet (2x 50 Ohm, 8x 75 Ohm), konzentriert sich der X-3 darauf, ein einziges Gerät mit einem sauberen Takt zu versorgen.
Damit muss der geneigte Kunde sich zunächst einmal entscheiden, ob er die D-2/X-3-Kombi als eine zusammengehörige Einheit sieht oder ob er mit seiner Masterclock auch zusätzlich noch Komponenten wie z.B. Switches oder Re-Clocker im Takt kontrollieren möchte.
Darf`s ein wenig mehr sein? A-1 oder A-2?
Vom Klangbild des Wandlers, vor allem im Zusammenspiel mit der Masterclock, angefixt, wollte ich jetzt unbedingt herausfinden, zu welchen (Klang-) Leistungen Soulnote beim klassischen Thema Verstärker in der Lage ist und habe mir den A-2 zum Ladenpreis von fast 6.990,- € kommen lassen.
Und das war ganz sicher kein Fehler.
Man sagt ja immer, dass man sich in eine klangliche Verbesserung erst ganz langsam hineinarbeiten muss, während man eine Verschlechterung sofort klar und deutlich wahrnehmen kann.
Doch was bedeutet es, wenn man deutlich teurere Verstärker gewohnt ist, aber sich mit dem A-2 keine „Verschlechterung“ einstellt?
Ich will hier nicht „die Welt auf den Kopf stellen“ und eine Diskussion darüber starten, ob nun eine Schwarzwälder Kirschtorte besser schmeckt als eine Herren-Sahne oder umgekehrt. Aber wollte ich bei diesem Beispiel bleiben, kann ich nur sagen, dass der A-2 ein wirklich “leckeres Törtchen” ist.
Und wie eingangs bereits gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis drückt hier mal nicht aus, dass der A-2 „für den kleinen Preis ja ganz in Ordnung ist“, sondern hier bedeutet dieser Begriff endlich mal: „Mir fällt kein zweiter Verstärker zu diesem Preis ein, der mir einen besseren Klang bescheren könnte.“
Ich bin mir sicher, dass es manch ein Kunde anders sehen wird und den Verstärker XY oder YX doch für viel besser hält. Das ist ja das tolle an diesem Hobby, dass wir Individualisten sein können und sein dürfen.
Und auch will ich ja mit diesem Bericht keineswegs bewirken, dass Sie auf einmal unzufrieden mit Ihrer vorhandenen Lösung werden sollen. Aber alle, die gerade auf der Suche nach einem neuen, endgültigen Verstärker sind und für die auch diese Preisklasse in Ordnung ist, die sollten sich unbedingt mal den Soulnote A-2 anhören.
Elektronische Kraft und musikalisches Feingefühl vereint der Soulnote A-2 in seiner Preisklasse in geradezu vorbildlicher Art und Weise.
Ob das an den revolutionären Ideen des Herrn Kato liegt oder einfach an einem genialen Konzept, das vermag ich nicht zu sagen. … ist mir auch egal.
Kommen wir zu meinen ersten Hörtests und beginnen wir mit dem
Hörtest Soulnote D-2
Für einen Kundentermin hatte ich gestern ein paar Titel zusammengestellt, die man auf Qobuz sowohl im Original als auch als DSD-Datei finden kann. Aus dieser Playlist spielte ich zum Auftakt des heutigen Hörtests „Spanish Harlem“ von Rebecca Pigdeon … und zwar in der DSD-Fassung (Audiophile Vocal Recordings 2006, SACD Chesky Records).
… und tappte sofort in eine böse Falle.
Seit Erscheinen des Albums „The Raven“ im Jahr 1994 gehört diese Aufnahme zu meinem festen Vorführ-Repertoir. Und zwar sowohl als Schallplatte als auch als CD, bzw. Gold-CD. Seit ein paar Jahren dann jetzt vor allem als Stream von Qobuz.
Hierzu muss man wissen, dass die Grundlage für die Schallplatte tatsächlich eine vollständig analoge Aufnahme (AAA) gewesen ist und man für die CD alle Titel im 24/96-Format eingespielt hat.
Dieses Album eignet sich daher wunderbar dazu, einmal völlig vorurteilsfrei an einen Test heran zu gehen und „komplett Analog“ mit „komplett Digital“ zu vergleichen. Obwohl hier von Chesky Records sehr viel Wert darauf gelegt wurde, die analoge Version tatsächlich auch „analoger“ klingen zu lassen, was im Großen und Ganzen auch tatsächlich gelungen ist, führt uns dieses Album an manchen Stellen ein wenig an der Nase herum und lässt die CD (z.B. beim Titel „Grandmother“) analoger klingen als die Schallplatte.
Leider weiß ich nicht, ob man für die DSD-Version die analoge oder die digitale Aufnahme als Basis gewählt hat. Tatsächlich klingt sie noch einmal anders als die beiden anderen.
Vor kurzem hat Chesky auch noch eine MQA-Version veröffentlicht. Da ich MQA überhaupt nicht mag, hab ich die Version noch nicht gehört und kann dazu also auch nichts sagen.
Kommen wir zur Falle:
Plötzlich waren die Musiker, die am Anfang so still wie möglich auf ihren Einsatz warten, viel deutlicher „zu hören“ als ich es in Erinnerung hatte.
Stellen Sie sich einen Raum vor, in dem sich mehrere Personen befinden, von denen niemand etwas sagt. Nehmen wir einen großen Aufzug oder ein Wartezimmer. Schließen Sie die Augen und versuchen Sie heraus zu finden, ob sie die Positionen dieser Personen „erhören“ können.
Das ist nicht immer ganz einfach und wir lassen uns auch gerne mal täuschen, aber eines ist sicher: Wir werden hören können, dass wir nicht alleine sind und erahnen können, wo die anderen Personen sich befinden.
Da sind viele kleine Geräusche, die uns Hinweise geben.
Und genau das passierte hier gerade in einem Ausmaß, das ich so nicht gewohnt war.
War dieser D-2 etwa derart „analytisch“, dass er alles, was ich bisher an Digital-Analog-Wandler gehört hatte, dermaßen in den Schatten stellen konnte?
Wenn das so wäre, müsste er dann nicht logischerweise „kalt und hart“ klingen?
Tat er aber nicht.
Rebecca Pigdeons Stimme ertönte sonor, souverän, fleischig, körperhaft und geradezu Gänsehaut erzeugend natürlich.
Aber vor allem: Immer beeindruckend.
Je länger ich hörte, umso mehr hörte ich Dinge, die in der Lage waren, mich zu beeindrucken.
Allerdings entfernte ich mich irgendwie ein Stück weit von dem, was man wohl „Musik“ nennt.
Das konnte so nicht am Soulnote liegen, denn dazu bewies er mir – sorry für die Wiederholungen – in beeindruckender Art und Weise seine musikalischen Fähigkeiten. Und jetzt bei dieser CD nicht so richtig.
Und natürlich wechselte ich auf das Original-Album „The Raven“.
Und …
sofort war wieder „alles in Ordnung“.
Zwar mit weniger Hintergrundgeräuschen und irgendwie weniger “beeindruckend” – aber musikalischer.
Wenn Sie das selber einmal nachvollziehen wollen, dann tun Sie das ruhig mal mit diesem Stück. Hören Sie sich das Original an und im Vergleich die DSD-Version. Vielleicht besitzen Sie ja sogar auch die CD/Gold-CD oder gar die Schallplatte?
Zurück zum Soulnote:
Jede komponenteneigene Färbung oder Eigenart erwies sich immer wieder als nicht existent. Genau so, wie es sein soll, ist der Soulnote D-2 in der Lage, jede vom Tonmeister gewollte klangliche „Stilrichtung“ deutlich zu machen und sie uns zur individuellen Bewertung zu präsentieren.
Sicherheitshalber verzichtete ich bei den nächsten Hördurchgängen darauf, solche klanglichen Abenteuer zu wagen und griff bei den Teststücken ausschließlich auf die üblichen „Verdächtigen“ zurück, die ich tagtäglich in meinem kleinen Studio zu Gehör bekomme.
Ergebnis:
Hut ab! Der Soulnote D-2 Digital-Analog-Wandler ist ein mehr als überzeugender Vertreter dieser Geräte-Gattung, die beweist, dass jeder qualitative Vergleich zwischen Analog und Digital längst ein Teil der HiFi-Historie geworden ist. Analog ist das Original – ganz sicher! Aber die heutigen digitalen Fähigkeiten sorgen für eine 1:1-Abbildung. Dadurch gibt es überhaupt kein „Besser“ und kein „Schlechter“ mehr. Der Soulnote D-2 erzeugt die perfekte Illusion, basta!
Mehr – kann man von einer HiFi-Anlage nicht erwarten.
Und die Masterclock?
Koppelt man die X-3-Clock an den D-2 DAC, passiert das, was mich an der High-Fidelity immer wieder so fasziniert.
Hätte man gerade eben noch mit großer Überzeugung unterschrieben, dass das Klangbild überhaupt nicht mehr verbessert werden kann, sitzt man plötzlich staunend vor seiner Anlage und fragt sich, woher denn das jetzt auf einmal noch kommt.
Sicher ist das immer noch der gleiche Aufnahmeraum und immer noch singt Rebecca Pidgeon, aber jetzt hat irgendwie einer das Licht angemacht, einen Vorhang weggezogen, die Milchglasscheibe entfernt …
Entscheiden Sie sich selbst für einen der von der Presse so oft zitierten Beschreibungen.
Wer diesen Unterschied einmal wahrgenommen hat, der mag einfach nicht mehr ohne Masterclock Musik hören. Es ist wie mit und ohne Brille zu sehen, wenn die Augen nicht mehr so wollen, wie sie es früher taten.
Masterclock ist nicht gleich Masterclock
Während der MUTEC REF10 SE120 am D-2 vor allem zu einer Verbesserung der Raumdarstellung führt, schafft es der X-3, einen Musiker punktgenauer in diesen Raum hinein zu stellen.
Allerdings muss man die beiden Masterclocks schon beide gut kennen, um die Unterschiede zu bemerken. Niemals wird man irgendwas von der einen Clock vermissen, wenn man nur die andere hört. Beide verbessern den Klang auf ganz erstaunliche Art und Weise.
MUTEC MC3+ USB
Und an dieser Stelle muss ich wohl erneut Reklame für den MC3+ USB von MUTEC machen. Ohne diesen Re-Clocker möchte ich einfach keine gestreamte Musik mehr hören. Mit keinem Streamer und keinem DAC. Aber das ist ein anderes Thema.
Vollverstärker Soulnote A-2
Bisher hatte ich den D-2 und den X-3 an meiner mir sehr gut bekannten Anlage gehört, um einfach die klanglichen Besonderheiten besser beurteilen zu können. Jetzt ging es darum, vollständig auf die Soulnote-Elektronik umzusteigen.
Neugierig war ich natürlich darauf, ob mich der A-2 ebenfalls in diese Falle mit dem Titel „Spanish Harlem“ laufen lassen würde. Und exakt so war es auch. Überhaupt wurde es für mich richtig schwer, einen Verstärkerwechsel festzustellen.
Konnte es sein, dass ein herausragender Entwickler aus Deutschland und einer aus Japan die selben Klangvorstellungen hatten?
Nun, theoretisch müsste man ja behaupten:
„Alle Entwickler haben das selbe klangliche Ziel, nämlich die authentische Wiedergabe des Originals!“.
Aber mal ganz ehrlich – eine solche Behauptung ist schon arg „romantisch“, um nicht zu sagen: naiv.
Hören Sie sich doch mal die altbekannten Verstärker an:
Die Transistoren, die digitalen Amps und dann noch diverse Röhrenteile.
Klingt da irgendwas genauso wie die anderen?
Nein! Tun sie nicht.
Und genau das wollen sie ja auch gar nicht.
Weil ja jeder von sich behauptet, der bessere Verstärker zu sein. Wie kann man der Bessere sein, wenn man genau so klingt wie die anderen? Also muss man zwangsläufig ein Klangbild erzeugen, was sich unterscheidet. Ein Klangbild, womit sich dann der markentreue Kunde identifizieren kann. Und das ist dann eben mal etwas „wärmer, voller, weicher“ und mal etwas „kälter, härter, analytischer“.
… nur leider unabhängig vom musikalischen Original … eben immer gleich.
Das will ich gar nicht verurteilen. So etwas nennt man „Charakter“ und damit arbeitet man überall. Organisieren Sie mal ein Treffen der Anhänger von verschiedenen Automarken. Von Fußballclubs mal ganz abgesehen!
Diesen wiedererkennbaren, typischen Charakter suchen wir beim Soulnote A-2 vergebens. In sofern könnte es der A-2 möglicherweise schwierig haben. Theoretisch.
So lange man ihn nicht gehört hat.
Falls Sie ihn hören möchten, können Sie dies ab sofort bei uns oder einem der anderen Soulnote-Händler tun. Ich freue mich auf Sie!
In unserer Vorführung haben wir aktuell:
Soulnote A-2
Soulnote D-2
Soulnote X-3 und das
Soulnote Clock-Kabel [...]
Lesen Sie weiter ...
22. Juli 2022Produktberichte / StreamingMUTEC MC3+USB und REF10 SE120 – weltweit führende Digitaltechnik – Made in Germany
In meinem Bericht „MUTEC MC3+USB und REF10 SE120 – weltweit führende Digitaltechnik – Made in Germany“ geht es heute um digitale Zusatzgeräte einer Berliner Manufaktur, die sich in der Profi-Welt schon seit Jahrzehnten einen hervorragenden Namen gemacht hat.
MUTEC schreibt zum MC3+USB:
Im Jahr 2013 erschien mit dem MC3+ das erste extern synchronisierbare Gerät der MC3-Linie. Dessen von MUTEC entwickelte 1G-Clock-Technologie setzte branchenweit neue Maßstäbe bei der Performance von „Low-Jitter“-Taktgebern und ermöglichte erstmals auch das sogenannte Audio-Re-Clocking, also das Neu-Takten digitaler Audiosignale.
Dieses war die entscheidende Funktionalität, durch welche der MC3+ nicht mehr nur im Studio Verwendung fand, sondern auch das Interesse der audiophilen Hörerschaft hervorrief.
2016 folgte die um einen USB-Zugang erweiterte und zusätzlich verbesserte Version MC3+USB. Mit diesem Gerät, welches die Klangqualität eines computerbasierten Musikwiedergabe-Systems (PC, Streamer, CD-Transport …) auf signifikante Art und Weise steigerte, gelang MUTEC der finale Einstieg in den weltweiten HiFi-Markt.
Ferner war (und ist) die generell bodenständige Preisgestaltung von MUTEC-Produkten gegenüber den im High-End-Segment üblichen Dimensionen ein relevanter Faktor für den Erfolg bei den engagierten Musikliebhabern.
MUTEC schreibt zum REF10 SE120:
Referenz der Referenztaktgeber
Der REF10 SE120 ist ein Referenztaktgeber, der den Begriff „Referenz“ in zweierlei Hinsicht mit Bedeutung füllt. Erstens aufgrund seiner Funktion: Er generiert einen optimierten zentralen Takt, auf den sich alle folgenden Geräte in der digitalen Audio‑Kette beziehen. Zweitens wegen seiner Qualität: Als Top‑Produkt von MUTEC setzt der REF10 SE120 einen neuen Standard in dieser Geräteklasse. Entscheidende technische Werte im Bereich von Phasenrauschen und Jitter stellen neue Bestmarken auf.
Was heißt das jetzt für uns HiFi-Freaks?
Wir verstehen, dass MUTEC Profi-Equipment für Profis wie z.B. Tonstudios fertigt und dass sie da „ziemlich gut“ – offensichtlich sogar weltweit führend – sind.
Auch haben wir erfahren, dass MUTEC nicht mit üblichen HiFi-Gewinnspannen arbeitet, was dieses Profi-Equipment auch für einen privaten Musikliebhaber interessant machen soll.
Nun, letzteres kann ich zumindest für den MC3+USB (1.299,- €) auch schon vor den ersten Hörtests bestätigen, denn die vergleichbaren Re-Clocker der Mitbewerber aus der HiFi-Szene liegen preislich allesamt deutlich über der MUTEC-Komponente.
Der REF10 SE120 ist da aber bei einem Preis von rund 6.000,- € ganz sicher kein „Schnäppchen“ mehr.
Er nimmt allerdings auch eine gewisse Alleinstellung ein.
Eine ähnlich hochwertige Clock, verbunden mit der hohen Flexibilität (50 Ohm- und 75 OHM-Anschlüsse) muss man erst mal finden. Und wenn wir in der Historie der Master-Clocks ein wenig zurückgehen, treffen wir da auch noch auf ganz andere Preiskategorien.
Am Ende werden Sie sich aber vermutlich immer noch fragen, ob – und wenn ja, wofür Sie diese beiden Geräte überhaupt benötigen. Und dieser Frage will ich in meinem heutigen Bericht etwas ausführlicher nachgehen.
Hinweis:
Dieser Bericht richtet sich nicht (!) an Fachleute oder technisch versierte Personen. Ich versuche hier, ein sehr kompliziertes Thema so einfach wie möglich darzustellen.
Null-Eins-Null-Eins …
Beide MUTEC-Geräte benötigen wir ausschließlich in der digitalen Welt.
Ein „Analogi“ kann mit ihnen nichts anfangen.
Richtig effektiv werden die MUTEC-Komponenten immer dann, wenn mehrere digitale Geräte miteinander kommunizieren. So, wie das natürlich in Tonstudios üblich ist.
In unserem HiFi-Hörzimmer kommen da in Frage:
CD-Transports
Streaming-Komponenten
Netzwerkplayer
Computer
Digital-Analog-Wandler
Analog-Digital-Wandler
Upsampler
Formatumwandler
Re-Clocker
Switches
Digitale Aufnahmegeräte
Aber wie profitieren diese Teile nun von einer MUTEC-Unterstützung? Brauche ich entweder den REF10 SE120 oder den MC3+USB oder brauche ich sie beide?
Lassen Sie mich zunächst einmal beschreiben, worum es hier eigentlich geht:
Die Clock
Das erste wichtige Stichwort lautet „CLOCK“ – zu übersetzen mit: Taktgeber.
Jedes Gerät und jede Baugruppe, die digitale Musiksignale zu verarbeiten haben, besitzen eine Clock und sind auf diese angewiesen.
„Der Takt macht die Musik“
… so sagt es eine alte, einfache Weisheit.
Doch ganz so einfach wie man sich die Sache vorstellt, ist das mit dem Takt gar nicht. Weder beim Musizieren, noch bei der digitalen Musik-Aufzeichnung.
Die Rolle des Takts in der Musik
Punkt 1: Der richtige (!) Takt (die Zählweise)
In der Musik kennen wir eine Menge unterschiedlicher Takte. Im europäischen Raum sind das vor allem der Drei-Viertel-Takt (Walzer) und der Vier-Viertel-Takt (z.B. Foxtrott).
Punkt 2: Die Geschwindigkeit – Beats per Minute (BPM)
Man kann jeden Takt schneller oder langsamer spielen. (wie beim Wiener Walzer oder Langsamen Walzer)
Punkt 3: Den Takt halten!
Ein Musiker sollte den gewählten Takt halten können, also nicht im gleichen Stück mal schneller und mal langsamer werden.
Punkt 4: Gemeinsam im Takt spielen
Immer dann, wenn mehrere Musiker gemeinsam Musik machen, kommt es nicht nur darauf an, dass sie den selben Takt (also z.B. einen Drei-Viertel-Takt) spielen, sondern auch darauf, dass sie ihn im Gleichtakt spielen. Um dies zu erreichen, richten sich kleinere Gruppen oft nach dem taktsichersten Musiker und größere Orchester benötigen einen Dirigenten.
Was bedeuten diese Erkenntnisse aus der Musikwelt für die digital aufgezeichnete Musik?
Vom analogen zum digitalen Signal
Um dies zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal vor Augen führen, wie ein analoges Musiksignal digitalisiert wird.
Schauen wir uns hierzu eine (ganz einfache) analoge Signalkurve an:
Im Vergleich dazu jetzt die Digitalisierung am Beispiel der CD-Auflösung:
Das Format einer CD liegt bei 16 Bit und 44.1 kHz, was bedeutet:
44.100 Mal pro Sekunde wird die analoge Signalkurve bei der Umwandlung in ein digitales Signal abgetastet.
44.100 Mal pro Sekunde (das ist die Zeitachse) wird also „nachgesehen“, an welcher Stelle (wie hoch/tief) die Kurve steht.
Um die Höhe (Dynamiktiefe) exakt zu bestimmen, arbeitet das CD-Format pro gelesener Information (Sample) mit einer Reihe aus 16 Nullen und Einsen, aus denen sich (rechnerisch!) 65.536 (= 2 hoch 16) verschieden hohe Pegelzustände ableiten lassen.
Beim High-Resolution-Audio-Format (24Bit bei 96 kHz) wird also sogar 96.000 Mal pro Sekunde eine 24-stellige Reihe aus Nullen und Einsen geschrieben und gelesen. Das sind (wieder rechnerisch!) 16.777.216 (= 2 hoch 24) verschieden hohe Pegelzustände pro Sample.
Obwohl diese theoretischen Möglichkeiten aus technischen Gründen nicht ausgenutzt werden, haben wir es hier mit unvorstellbar vielen Informationen zu tun und man sollte annehmen, dass das mit einer extrem hohen Klang-Qualität einhergehen sollte.
Leider ist das aber beim CD-Format noch nicht so ganz der Fall gewesen, weshalb heute noch viele Musikliebhaber (selbst “Digitalos”) den CD-Klang als zu „künstlich“ empfinden.
Ist digital also immer noch schlechter als analog?
Aus den Erfahrungen mit der CD heraus den Schluss zu ziehen, dass das digitale Format grundsätzlich und damit für „immer und ewig“ dem analogen Format unterlegen bleiben würde, war und ist von Grund auf falsch.
Heute stimmt das so einfach nicht mehr.
Zwar haben peinliche Dinge wie die MP3-Einführung in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es mit der digitalen Musik-Qualität schlechter statt besser wurde, aber diese unrühmlichen Zeiten sind vorbei und wirken sich heute auf den anspruchsvollen Musikmarkt mit seinem HRA-Streaming-Angebot zum Glück nicht mehr aus.
Parallele zur Fotografie
In der Fotografie lag die wichtige Schwelle, ab wann der Mensch ein digitales Foto nicht mehr als solches entlarven kann, bei etwa 12 MP (MegaPixel). Als diese Auflösung möglich wurde, war das menschliche Auge nicht mehr in der Lage, bei einem ausgedruckten Fotoformat von etwa 10×15 cm einen Unterschied zwischen einem analog und einem digital produzierten Bild auszumachen.
Im HiFi-Bereich haben sich die Tonmeister auf das „Schwellen-Format“ 24 Bit bei 96 kHz geeinigt. Denn bei diesem Format ist der Mensch nun auch nicht mehr in der Lage, digital von analog zu unterscheiden. Und anders als bei den Behauptungen des Fraunhofer-Instituts zur MP3-Datei, entsprechen diese Aussagen diesmal auch der Realität.
Eine solche digitale Kurve sieht im bildlichen Vergleich dann so aus:
Fazit:
Wir wissen nun, dass ein analoges Signal beim Digitalisieren 96.000 Mal pro Sekunde abgetastet und die Höhe der Signalkurve durch eine 24 Bit “Wortbreite” beschrieben wird. (HRA-Format)
Mit diesem Wissen können wir uns jetzt etwas genauer anschauen, was beim Lesen eines digitalen Signals von Bedeutung ist.
Der Takt im digitalen System
Beginnen wir wieder mit dem Thema Takt an sich
Genau wie bei einer Musikgruppe, bei der ja auch alle wissen sollten, ob sie jetzt einen Walzer oder einen Foxtrott spielen werden, muss eine Komponente wissen, ob sie 44.100 Mal/Sekunde die 16Bit-Samples auslesen muss oder 96.000 Mal die 24Bit-Samples.
(… oder ein anderes Format)
Nun – diese Aufgabe sollte schnell erledigt sein. Eine in der Datei eingebettete Info genügt hier.
Die Takt-Formate bei der digitalen Musikspeicherung
Im Audio-Bereich finden wir heute üblicherweise die beiden Frequenzreihen 44,1 kHz, 88,2 kHz, 176,4 kHz und 48 kHz, 96 kHz, und 192 kHz.
Wobei auffallen sollte, dass sich die beiden Frequenzen 44,1 kHz und 48 kHz parallel zueinander immer schrittweise verdoppeln. Leider passen die beiden Frequenz-Reihen mathematisch überhaupt nicht zusammen, was Digital-Analog-Wandlern Probleme bereitet und was daher bereits eine Ursache für ein nicht so tolles Klangbild sein kann.
Will man eine Audio-Datei aus der einen Frequenzreihe in eine Frequenz aus der anderen Reihe umwandeln, führt das unweigerlich zu Qualitäts-Verlusten, wie wir sie von minderwertigen DA-Wandlern kennen.
Bessere Wandler arbeiten deshalb mit zwei (!) optimierten Clock-Frequenzen und schalten je nach zugeführtem Format zwischen ihnen hin und her. Das ist dann manchmal dieses Klicken, was wir zwischen den Titeln hören können.
Kommen wir zu den Themen „Geschwindigkeit“ und „im Takt bleiben“.
Die Takt-Geschwindigkeit sollte uns theoretisch gar keine Sorgen machen können, ergibt sie sich ja logischerweise aus der verwendeten Frequenz. Schließlich reden wir hier z.B. von 96.000 Mal pro Sekunde – was man in der Musik wohl mit BPM (Beats per Minute) beschreiben würde.
Dass dieser Lese-Takt stabil bleiben muss, versteht sich von selbst, denn schon minimalste Abweichungen führen zum Daten-Chaos und das System liest den falschen Sample oder nur Unsinn!
Die kleinsten Zeitfehler, oft auch mit “Taktzittern” bezeichnet, nennt man “Jitter”. Dass auch sie die Klangqualität nicht gerade verbessern, dürfte einleuchten.
Jitter kann sich aber nicht nur beim Lesevorgang ergeben, sondern auch auf dem kompletten Signalweg. Ein schlechtes Kabel, eine minderwertige Buchse … und die Jitterwerte steigen an. Das kann sogar zu hörbaren Störungen oder zum Totalausfall des Signals führen.
Nun zum Thema „Gleichtakt“
Für einen einzelnen, taktsicheren Musiker ist dieses Problem nicht vorhanden und für eine einzelne, hochwertige digitale Komponente eben auch nicht.
Das ändert sich hier wie dort, wenn mehrere Musiker/Komponenten zusammen Musik machen sollen.
Genau in diesem Moment kommt es nämlich nicht nur darauf an, dass sie beide den gleichen Takt einhalten, sondern sie müssen ihn auch “synchron”, also im Gleichtakt einhalten. Das ist ein großer Unterschied!
Wir wollen: Eins-Zwei-Drei, Eins-Zwei-Drei … und zwar von allen Musikern!
und nicht Eins-Eins-Zwei-Zwei-Drei-Drei-Eins-Eins-Zwei-Zwei-Drei-Drei… 🙂
Damit das funktioniert, ernennt sich das digitale Quellgerät, z.B. der CD-Transport, zum “Master” und degradiert alle nachfolgenden Komponenten-Clocks zu “Slaves”.
Der CD-Transport wird also zum Dirigenten, dem alle Musiker (Clocks) zu folgen haben.
Lassen Sie sich nun aber bitte nicht dadurch verwirren, dass sich der CD-Transport zum “Master” ernennt. Deshalb wird er noch lange nicht (!!) zur “Master-Clock”! Dazu später mehr.
Master – Slave
Im technischen Bereich werden diese beiden Begriffe schon immer gerne genutzt. Man kann mit ihnen zum Ausdruck bringen, dass es das eine Gerät gibt, was etwas „zu sagen hat“ (Master) und andere, die auf das zu hören haben, was vom Master bestimmt wird. Das sind dann die Slaves.
Durch diese Methode können sich die Clocks digitaler Musik-Komponenten auch ohne eine Master-Clock synchronisieren, was eine zwingende Voraussetzung für die klanggetreue Musikwiedergabe darstellt.
Nach so viel Takt sollten wir uns jetzt vielleicht noch einmal einige weitere Punkte etwas genauer betrachten.
Sorry – aber ein wenig Theorie muss sein.
Was ist eigentlich eine Clock?
Die Clock ist ein Taktgeber. Für diesen Baustein greift man auf Schwing-Quarze zurück.
Diese Quarze gibt es in natürlicher und in künstlich hergestellter Form. Die Herstellung ist in beiden Fällen kompliziert und bei den angegebenen Schwingungsfrequenzen handelt es sich in der Regel um Circa-Werte, die im Nachhinein auch nicht mehr verändert werden können. Den HiFi-Entwicklern fällt daher die schwierige Aufgabe zu, sowohl Quarze zu selektieren, als auch durch eine entsprechende elektronische Regelung dafür zu sorgen, dass am Ende brauchbare Frequenzen vorhanden sind.
Mehr über Schwing-Quarze finden Sie im Netz, z.B. auch bei Wikipedia.
Bestimmt die Clock also die Qualität einer digitalen Komponente?
Da wir in Digital-Komponenten sowohl bei den Quarzen als auch bei den Regelungen auf unterschiedliche Qualitäten stoßen, kommt es in der Praxis tatsächlich zu unterschiedlichen Klang-Ergebnissen und damit eben auch zu Qualitätsunterschieden.
Manche Hersteller setzen bei den Quarzen extrem aufwändige Selektionsverfahren ein, die sich dann natürlich später im Preis der Komponente widerspiegeln.
Word-Clock
Dies ist kein elektronischer Baustein!
Mit Word-Clock bezeichnet man die Frequenz und die Wortbreite, mit der ein analoges Signal digitalisiert wurde. Also z.B. 44,1 kHz bei 16 Bit (CD-Format).
Ein Solitär (CD-Player, All-in-One-Streamer …) kann diese Informationen aus der digitalen Datei herauslesen und sich unabhängig von anderen Komponenten darauf einstellen.
Kommt es zu einer mehrteiligen Geräte-Kombination, übernimmt (wie wir bereits wissen) das Quellgerät (z.B. der CD-Transport) die Aufgabe eines Masters und sorgt nicht nur dafür, dass alle Clocks in den nachfolgenden Geräten die Information über den Takt (z.B. 44,1 kHz) erhalten, sondern auch dafür, dass sie mit seiner Clock im Gleichtakt schwingen.
Die Master-Clock
Die Master-Clock ist immer eine externe Komponente mit Anschlüssen für mehrere digitale Geräte.
Sie ist sozusagen der Dirigent, der allen Komponenten (Musikern) den korrekten Takt vorgibt.
Und genau wie in einem Orchester sorgt auch hier der Dirigent dafür, dass taktschwache Musiker oder in unserem Fall minderwertige Clocks die hohe Qualität der Master-Clock übernehmen und somit Präzisionsleistungen vollbringen, zu denen sie ohne die Master-Clock niemals in der Lage wären.
Hierdurch erklärt sich auch, dass selbst eine einzelne (!) Komponente, die wir an eine Master-Clock anschließen, sofort mit einem besseren Klangbild reagiert. Auch ein einzelner taktunsicherer Musiker würde ja von einem Dirigenten profitieren.
Welche Komponenten mit Clock-Anschluss finden wir eigentlich auf dem Markt?
Dank der zurzeit steigenden Nachfrage, die belegt, dass der Kunde gerne eine konsequente, professionelle Lösung einsetzen möchte, denken immer mehr Hersteller um und statten ihre Geräte mit einem Anschluss für eine Master-Clock aus.
Switches wie die von SotM oder Silent Angel werden von den Kunden explizit auf Grund ihres Clock-Anschlusses ausgewählt.
Digital-Analog-Wandler mit Clock-Anschluss suchen wir heute noch wie die Nadel im Heuhaufen.
Ich selber agiere da zurzeit auf zwei Ebenen..
Zum einen versuche ich, unsere Hauptlieferanten dazu zu bewegen, ihre Geräte mit einem Clock-Anschluss auszustatten. Hier ist aber noch reichlich Überzeugungsarbeit zu leisten. Und mir ist ja auch klar, dass so etwas nicht einfach damit getan ist, eine zusätzliche Buchse in die Rückwand zu schrauben.
Zum anderen setze ich mich gerade mit den wenigen auf dem Markt befindlichen Wandlern näher auseinander und prüfe sie darauf, ob ich sie in mein Portfolio aufnehmen möchte.
Weder haben wir einen Nutzen von einem DAC mit Clock-Anschluss, der selbst mit einer Master-Clock schlechter klingt als andere ohne, noch zeigt sich ein Benefit, wenn die Geräte in Deutschland nicht ordentlich und seriös vertrieben werden.
Zu diesem Thema sollten Sie also bei Interesse weiter meine Seite verfolgen. Das eine oder andere könnte sich da schon recht schnell tun.
Bei den Quellgeräten wird es wohl noch längere Zeit mau aussehen, denn die ernennen sich ja gerne selber zum Master und wollen dann nicht auf einen “Über-Master” hören. Dabei sind es gerade sie, auf die es ganz besonders ankommt.
Und genau das ist der Grund, weshalb Sie sich zumindest den MUTEC MC3+USB genauer anschauen sollten. Er sorgt dafür, dass digitale Fehler und Mängel der Quellgeräte bereinigt werden. Mit herausragenden Werten bei den Rauschabständen und den Jitterwerten. Da der MC3+USB selbstverständlich über einen Master-Clock-Anschluss verfügt, sorgt er sozusagen automatisch dafür, dass jedes angeschlossene Quellgerät einen Master-Clock-Anschluss erhält. Ein zusätzlicher Anschluss am Quellgerät ist damit nicht mehr notwendig.
Kommen wir kurz zum MUTEC REF10 SE120
Diese externe Clock ist derzeit das „Must-Have“ in der obersten Klang-Kategorie. Von Profis für Profis.
Hinzu kommt der große Vorteil, dass der MUTEC REF10 SE120 sowohl über sechs 75-Ohm- als auch über zwei 50-Ohm-Ausgänge verfügt.
Die 75 Ohm haben sich bereits bei Übertragung der Word-Clock z.B. bei Zusatzgeräten und Switches etabliert. 50 Ohm gelten als Standard für z.B. Digital-Analog-Wandler.
Bei den meisten Mitbewerbern müssen wir uns für das eine oder das andere entscheiden. MUTEC hat an uns gedacht und stellt uns beide Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Das macht den MUTEC REF10 SE120 natürlich äußerst zukunftssicher.
Re-Clocker MUTEC MC3+USB.
Während der REF10 SE120 den Dirigenten darstellt, der allen Musikern den korrekten Takt vorgibt, kümmert sich der MC3+USB darum, den instabilen und unsauberen Takt eines einzelnen “Musikers” zu berichtigen
Verbinden wir das USB-Kabel des Quellgeräts (heute meistens des Streamers) mit dem MUTEC MC3+USB, trennt der MC3+USB im ersten Schritt die Audio-Bit- von den Taktsignalen und verwirft dann die eingegangenen Taktsignale komplett. Inklusive Störungen, Rauschen und Jitter.
Im zweiten Schritt baut er sie dann vollständig wieder neu auf. Das Ergebnis sind wohl die derzeit niedrigsten erreichbaren Jitter-Werte überhaupt.
Ausgegeben werden die so aufbereiteten Signale dann nicht wieder über USB, sondern vornehmlich über AES/EBU, aber auch über Coax oder BNC, da diese Schnittstellen in der Regel höhere Qualitäten aufweisen als die meisten USB-Anschlüsse.
Zu USB:
Immer noch werden die USB-Schnittstellen vor allem von DAC- Entwicklern als minderwertig betrachtet und daher vernachlässigt. Auch bei Herstellern halten sich eben manche Vorurteile hartnäckig über eine sehr lange Zeit. Und so lange schlechte USB-Schnittstellen verbaut werden, kann sich an diesem Vorurteil auch nichts ändern. Ein Teufelskreis!
Dem entgegen steht die Tatsache, dass immer mehr Quellgeräte auf USB setzen, auch im Hochpreis-Sektor. Wodurch die DAC-Entwickler gezwungen werden nachzubessern.
Der MUTEC MC3+USB kann da so ein Retter in der Not sein, da er eingangsseitig mit USB und ausgangsseitig mit AES/EBU, Coex, Toslink und BNC arbeitet.
Genau genommen erfüllt der MC3+USB dadurch vier (!) Geräte-Funktionen:
Erstens: Als Re-Clocker bereinigt er die digitalen Taktsignale.
Zweitens: … bildet er eine Schnittstellenumwandlung für DAC, die keinen (guten) USB-Eingang besitzen.
Drittens: … stellt er uns für das Quellgerät einen Quasi-Anschluss für die Master-Clock zur Verfügung.
Viertens: … ist er in der Lage, digitale Formate umzuwandeln. (DSD zu PCM …)
Zusammenfassung:
Seitdem wir durch das Streaming Zugang zu High-Resolution-Audio-Dateien erhalten haben und sich damit die digitale Musik stolz und gleichwertig neben der analogen Musik positioniert, werden auch die wahren Problemstellen einer digitalen Kette immer deutlicher und können so gezielt bekämpft werden.
Während wir beim Plattenspieler kritische Punkte wie die Entkoppelung, die Justage, den elektrischen Abschluss usw. kennen, treffen wir beim digitalen Equipment auf das Thema „Takt“.
Und wer hier nicht immer und ewig hinter der analogen Klangqualität zurückbleiben will, sollte sich um dieses Thema kümmern. Mit den beiden in diesem Bericht beschriebenen Komponenten von MUTEC bekommt er jedenfalls außerordentlich konsequent entwickelte Gerätschaften an die Hand. Ob ihm schon ein MUTEC MC3+USB ausreicht, oder ob er sich zusätzlich eine solch feine externe Clock wie den MUTEC REF10 SE120 gönnen sollte, hängt von der Konstellation seiner Anlage, vom eigenen Anspruch und natürlich vom zur Verfügung stehenden Budget ab.
Was sich durch die MUTEC-Geräte klanglich tun könnte, will ich nun im Folgenden näher beschreiben.
Hörtest – Teil 1 (ohne Musikbeispiele)
Ich beginne mit dem MC3+USB solo und verbinde ihn über das USB-Kabel meines PrimeMini 5/i7 Max.
Hierzu sollte man folgendes wissen:
Bisher haben Re-Clocker am USB 3.0-Ausgang des PrimeMini enorme Klangverbesserungen gebracht, am USB 2.0-Ausgang jedoch so gut wie gar keine. Der Klang über den USB 3.0-Ausgang mit angeschlossenem Re-Clocker hob sich zudem kaum bis gar nicht über das Ergebnis hinaus, was der USB 2.0-Ausgang schon von sich aus brachte, also ohne zusätzlichen Re-Clocker. Weshalb mein Tipp bisher logischerweise lautete:
Nutzen Sie den USB 2.0-Ausgang und sparen Sie sich den teuren Re-Clocker. Zumindest dann, wenn Ihre Komponente über einen solch guten USB 2.0-Ausgang verfügt wie ein PrimeMini aus der Schweiz.
Mit dem MC3+USB hat sich dies nun tatsächlich geändert. Er bestätigt zunächst, wie mies diese USB 3.0-Ausgänge leider für uns audiophilen Hörer sind und sorgt sofort für einen mehr als erträglichen Klang – auch über diese Schnittstelle.
Im zweiten Durchgang schafft er es aber auch, das Klangbild des USB 2.0-Ausgangs zu verbessern. Mehr Ruhe, mehr Stabilität, mehr Volumen, mehr Dynamik und ein noch realistischer abgebildeter Aufnahmeraum sind wohl die wichtigsten Feststellungen.
Nach nur wenigen Titeln muss ich meine bisherige Meinung also revidieren und kann bestätigen, dass der MC3+USB auch an einem USB 2.0-Ausgang eine Klangverbesserung hinbekommt. Am USB 3.0-Ausgang ist er praktisch Pflicht!
Ich mache den nächsten Schritt und schließe den MC3+USB an den REF10 SE120 an.
Zwar habe ich die REF10 SE120 bereits etwa 4 Wochen am Strom, aber dennoch gönne ich dieser Kombi erst einmal eine Nacht, um sich aneinander zu gewöhnen. Man weiß ja nie.
Am nächsten Tag stellt sich dann die zweite Überraschung ein. Ich zweifle keinen Moment daran, dass der klangliche Zugewinn durch die externe Clock größer ist als der Zugewinn allein durch den MC3+USB. Das mag einem jetzt nicht viel helfen, weil ich ja hier nicht entweder den MC3+USB oder den REF10 SE120 alleine testen kann. Mit dem REF10 SE120 kann ich ja ohne den MC3+USB in meiner Test-Konstellation gar nichts anfangen.
Um vielleicht doch eine Erfahrung mehr zu bekommen, versuche ich im nächsten Schritt etwas anderes:
Ich wechsle vom Innuos-Phönix-Switch, der leider keinen Anschluss für eine externe Clock hat, auf den Silent Angel Bonn N8 Pro CLK. Zunächst ohne auch ihn an den MUTEC REF10 SE120 anzuschließen.
Sofort kann ich feststellen, dass es zwischen dem Bonn und dem Innuos einen den Listenpreisen entsprechenden Klangunterschied gibt. Der Innuos geht kräftiger zur Sache und tönt stabiler als der Bonn Pro.
Nun aber gönne ich dem Silent Angel Switch die Verbindung zur Master-Clock MUTEC REF10 SE120 und ohne wieder eine Nacht warten zu wollen, stellt sich auf Anhieb eine Klangverbesserung ein, mit der sich der Bonn Pro sogar an dem Innuos vorbeischieben kann.
Ich hatte das bereits bei der SotM-Kombi so ähnlich beobachten können. Auch hier wird die Klangqualität des sNH-10G-Switches durch die SotM-Clock so stark verbessert, dass sich der SotM-Switch vom dritten Platz auf den ersten kämpfen konnte.
Leider steht mir gerade kein SotM-Switch zur Verfügung, da die Geräte derzeit nicht lieferbar sind, aber auch der Bonn N8 Pro CLK verrichtet hier seine Aufgaben gerade vorbildlich und liefert mir die Antworten, die ich gesucht habe.
Zum Abschluss meines Hör-Tests will ich dann aber doch noch mal etwas wagen, wozu mich die Kollegen aus dem Redaktionsbereich geradezu gedrängt haben: Ich werde den MC3+USB kaskadieren!
Klartext:
Ich gehe mit dem USB-Kabel aus dem PrimeMini heraus in den ersten MC3+USB. Dann gehe ich mit einem AES/EBU von Progressive Audio in den zweiten MC3+USB und dann von dort aus mit einem weiteren AES/EBU-Kabel von Progressive Audio in den DAC. Beide MC3+USB und der Switch sind natürlich über ein SotM-Clock-Kabel mit dem REF10 SE120 verbunden.
Ergebnis:
Keiner meiner Kollegen und Vor-Autoren haben übertrieben oder irgendwas schön gefärbt. Was hier gerade läuft, das treibt mir den Ausdruck „perfekt“ in den Sinn. Perfekt ist perfekt – besser geht es nicht.
Auch wenn ich weiß, dass diese Aussage morgen schon wieder hinfällig sein wird.
Fazit des Hörtests:
Wer eine digitale Quelle wie einen CD-Transport oder einen Streamer nutzt, der sollte sich wenigstens testweise mal einen MC3+USB anhören. Wer ihn danach wieder zurückgeben kann, der muss in seiner Kette an anderer Stelle noch einen echten Flaschenhals haben.
Wer mit dem Anspruch lebt, aus seinem digitalen Strang den bestmöglichen Klang erzeugen zu können, der wird sich wohl daran gewöhnen müssen, dass er irgendwann so eine Clock-Zentrale wie den MUTEC REF10 SE120 benötigt. Erst vielleicht nur für den Switch. Im zweiten Schritt dann aber sicher auch für den passenden DAC … und den MC3+USB!?
Hörtest Teil 2 – Musikbeispiel “Keith don`t go”, Nils Lofgren
Auf die Gefahr hinaus, dass ich mir wieder viele Feinde mache, habe ich ganz bewusst diesen Titel ausgewählt.
“Wer ihn nicht kennt, hat die High-Fidelity verpennt.” so muss man es wohl sagen. Und eben weil dieser Titel so bekannt ist und vielen Vorführern “aus dem Halse hängt”, eignet er sich ausgezeichnet dafür, deutlich zu machen, was sich jetzt plötzlich in einer Deutlichkeit tut, die viele von uns zuvor noch nicht erlebt haben.
Wichtig: Ich beziehe mich auf die Aufnahme in Qobuz. Manche Portale haben eine andere Version online.
Ein Ton ist ein Ton – könnte man sagen. Und ein auf der Gitarre gespieltes C ist und bleibt ein C. Ja, sicher!
Aber haben Sie es schon mal erlebt, dass Ihnen ein einziger Ton eine ganze emotionale Geschichte erzählt?
Das Faszinierende an der High-Fidelity ist ja, dass sie uns manchmal vergessen lässt, ob wir den Titel mögen oder nicht; ob wir den Interpreten mögen oder nicht.
Ich habe schon Kunden in meinem Studio bei einer Opern-Arie weinen sehen, die noch kurz vorher gemeint haben: “Bloß keine Klassik! Und schon gar nicht so ein Gequietsche!”.
Wenn man sich einen Titel anhört, den man eigentlich nicht mag und danach sagt: “Das war eine musikalische Meisterleistung!”., dann war das High-End!
“Keith don’t go” offenbart gnadenlos vorhandene Zeitfehler, bereitet uns bei zu hell und metallisch abgestimmten Anlagen Ohrenschmerzen, lässt uns zusammen mit zu müde klingenden Ketten “versumpfen” und deckt deutlich die Fähigkeiten auf, eine Live-Atmosphäre authentisch darstellen zu können. Sind es Stahlsaiten, sind es Nylon-Saiten? Ist es eine Holzgitarre oder eine aus Metall? Spielt Lofgren hektisch oder schläft er fast ein?
Wirklich alles (!) habe ich auf Messen und Ausstellungen schon erleben müssen.
Das seltsame an dem Stück ist:
Oft hört es sich dennoch “richtig” an – man bemerkt die falsche Wiedergabe manchmal gar nicht.
Heute jedoch hält sich diese Berg- und Talfahrt in winzig kleinen Grenzen und doch geht es hinauf und hinunter, je nachdem, welche dieser MUTEC-Teile ich integriere.
Allein mit dem MC3+USB gewinnt das Klangbild an Souveränität und Stabilität. Lofgrens Spiel wird sicherer, selbstverständlicher.
Nimmt man den REF10 SE120 dazu, nehmen einzelne Töne unendlich viele Klangfarben an und werden zu Musikstücken innerhalb der Musik. Spätestens wenn wir dann den Switch und zwei MC3+USB zusammen am REF10 SE120 betreiben, haben wir das Gefühl, wir könnten uns einen einzelnen Saitenzupfer Lofgrens herauspicken und einen ganzen Aufsatz darüber schreiben, wie der Klang sich innerhalb von Sekundenbruchteilen verändert, bis er endlich verhallt. Unglaublich!
Ein Zurück ist überhaupt nicht denkbar.
In “Vollausstattung” hören wir z.B. fünf aufeinanderfolgende Töne. Ohne die MUTEC-Komponenten können wir gar nicht sagen, ob das jetzt gerade ein Akkord gewesen sein soll oder eine Tonreihenfolge. Irgendwie wird aus “ping-ping-ping-ping-ping” so etwas wie “prritsch”. Nicht so, dass man glaubt, ein Störgeräusch gehört zu haben, aber doch so, dass man der Meinung sein könnte, Lofgren müsse da noch mal an seiner Technik arbeiten.
Schlusswort
Ich muss zugeben, dem Aspekt “Clock” bisher im Vertrauen auf die Hersteller keine so große Bedeutung gegeben zu haben. Und meine bisherigen Erfahrungen mit Komponenten aus dem Musikerbereich, verliefen durch die Bank auch eher enttäuschend. Ob die Zeit jetzt einfach reif ist oder ob ich mit MUTEC einen ganz außergewöhnlichen Hersteller entdeckt habe, vermag ich nicht zu sagen. Nur, dass ich diese Teile ganz sicher nicht wieder hergeben werde.
Zum Mutec MC3+USB
Zum Mutec REF10 SE120
[...]
Lesen Sie weiter ...
20. Juli 2022Produktberichte / StreamingSilent Angel Bonn NX
Silent Angel Bonn NX
Schon seit einigen Wochen hat uns Silent Angel einen audiophilen Switch Namens “Silent Angel Bonn NX” versprochen, der endgültig die Frage beantworten soll, welcher Switch denn wohl gerade auf dem Markt der allerbeste sei.
Große Worte, oder?!
Um unsere Meinung schon im voraus zu beeinflussen?
Oder uns eine Begründung für den Preis von 3.498,- € zu liefern?
Oder ist es pures Selbstbewusstsein?
Ich wollte es herausfinden, habe den NX rechtzeitig geordert und gestern ist er angekommen.
Wenn Sie sich nun fragen, worüber ich hier eigentlich schreiben will und was denn wohl ein Netzwerk-Switch mit dem Klang einer HiFi-Anlage zu tun haben soll …
… wo man ihn doch in den meisten Fällen überhaupt nicht benötigen wird, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, sich zunächst einmal mit dem Einsteigermodell, dem Bonn N8 zu befassen. Er kostet etwa 400,- € und ist sehr gut in der Lage, jedem Zweifler zu zeigen, wie sinnvoll und klangverbessernd der Einsatz eines Netzwerkswitches sein kann.
Wer diese Einsteigerphase hinter sich lassen will und kein Freund von teuren Zwischenlösungen ist, der tut allerdings gut daran, meinen Bericht weiter zu lesen.
Verpackung
Ich bin überhaupt kein Freund von diesen YouTube-Unboxing-Filmchen, bei denen man sieht, wie jemand irgendetwas aus dem Karton packt.
Aber dieser Karton hier, der hat mal eine “amtliche” Größe und ein erstaunliches Gewicht.
Da will man das doch fast auf You…
Nein, besser nicht.
Füße
Wer es gewohnt ist, bei seinen HiFi-Zubehörgeräten als erstes die Billig-Plastik-Füße gegen gescheite Absorberfüße auszutauschen, der kann sich diese Arbeit beim Bonn NX definitiv sparen. Diese Füße wären echt zu schade, um sie zu ersetzen.
Gerätesicherung
Auch wenn es leider meine Lieblingssicherung (die PADIS) nicht mehr zu kaufen gibt, so weiß ich dennoch um die klangliche Bedeutung einer Gerätesicherung. Blöd nur, wenn man dann zum Wechseln der Sicherung das Gehäuse komplett zerlegen und dabei irgendwelche Garantieaufkleber zerstören muss.
Silent Angel scheint sein Klientel gut zu kennen. Am Geräteboden gibt es den Sicherungshalter und somit ist die Sicherung in diesem Fall supereinfach auszutauschen. Hut ab!
Der Wert der Sicherung liegt bei T1A – also eine gängige Größe, auch für spezielle audiophile Sicherungshersteller.
Das Gewicht
Kann man die meisten Switches locker mit einer Hand anheben (z.B. um mit der anderen darunter Staub zu wischen), kann man sich diesen Versuch beim Silent Angel Bonn NX ganz sicher sparen.
Satte 6,4 kg, verteilt auf einer Fläche von 44×25 cm, die muss man erst mal einhändig stemmen können. Mir gelingt das jedenfalls nicht.
Das Design
Der Silent Angel Bonn NX ist kein kleines Zubehörteil, was man noch in irgendeinem Fach seines HiFi-Racks zusätzlich unterbringen kann. 44 cm sind Komponenten-Standardbreite und somit verlangt der Bonn NX nach einem eigenen Regal im Rack – ganz für sich alleine.
Und ganz ehrlich: Dieses Gehäuse ist auch viel zu edel dafür, irgendwo ungesehen hinter einem Rack zu verschwinden.
Auf der Front befinden sich keinerlei flackernden LEDs. Sie ist insgesamt an Schlichtheit kaum zu überbieten. Mein Vorführgerät ist noch mit einer sehr dezenten blauen Beleuchtung im unteren Teil ausgestattet. Es muss aber wohl so viel Kritik gehagelt haben, dass Silent Angel diese Beleuchtung demnächst weglassen will. Schade eigentlich.
Auf der Rückseite befinden sich alle notwendigen Anschlüsse – und zwar endlich einmal weit genug voneinander entfernt, um auch breitere LAN-Stecker problemlos nebeneinander einstecken zu können.
Stromversorgung
Etwas widersprüchlich geht Silent Angel hier mit den Optionen zur Stromversorgung um. Einerseits lobt man das interne Netzteil und stellt es als klanglich herausragend dar, andererseits gibt es aber zusätzlich auch eine 12V-Eingangsbuchse. Also kann man das tolle interne Netzteil auch komplett umgehen und dem Bonn NX stattdessen Strom aus einer externen Stromversorgung (Forester F2, Keces …) zuführen.
Wir alle wissen mittlerweile, welchen großen Anteil ein audophiles Netzteil am Klanggeschehen haben kann, aber wieso man dann den Bonn NX auch noch mit einem 230V-Anschluss und einem außergewöhnlich hochwertigen internen Netzteil versorgt, erschließt sich mir so auf Anhieb nicht.
Erdungsklemme
Sie kennen wir eigentlich nur vom Plattenspieler. Und haben uns auch schon oft genug über sie geärgert. Mal brummt es, wenn wir vergessen haben, sie anzuschließen. Mal brummt es, wenn wir sie angeschlossen haben …
Hier beim Silent Angel Bonn NX brummt natürlich gar nichts!
Ob wir die Klemme erden oder nicht.
Sie übernimmt denn hier auch vielmehr die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich keine “Restpotentiale” ins Klanggeschehen einmischen.
Außerdem soll diese Erdung helfen, elektronisches Rauschen noch weiter minimieren zu können.
Masterclock-Anschluss
Auch beim Thema Clock denkt Silent Angel offensichtlich “doppelt hält besser”.
Hat man diesen Switch doch bereits mit hervorragenden, temperaturstabilisierten Clockbausteinen versehen, so gibt es an der Rückseite dennoch einen Anschluss für eine externe Masterclock.
Und erneut folgt Silent Angel nicht (!) einfach den Vorbildern aus der Profi-Welt und sorgt eben auch nicht (!) dafür, dass wir eine 10MHz-Masterclock (zum Beispiel die MUTEC Ref10 SE120) anschließen können. Silent Angel hat diesen Eingang bewusst mit 25MHz definiert, was ihn aber zunächst einmal nutzlos macht, da es meines Wissens nach eine solche Masterclock auf dem Markt nicht gibt.
Aber sie soll kommen. Natürlich von Silent Angel selber.
Wie genau die dann bestückt sein wird, ob mit nur einem Ausgang für den Switch, oder mit mehreren, das muss uns die Zukunft erst noch zeigen. Ich bin gespannt.
LAN-Buchsen
Davon finden wir insgesamt acht Stück, schön weit voneinander entfernt und hochwertig vergoldet. Darüber befindet sich ein kleiner mechanischer Schalter, mit dem wir die flackernden LED-Lichter ein- bzw. ausschalten können.
Ist damit also an alles gedacht?
Nun, nicht so ganz. Ich hätte mir noch einen SFP, also einen Eingang für Glasfaserkabel gewünscht. Alle, die mittlerweile auf LWL umgestiegen sind und davon ganz sicher nicht wieder abkehren möchten, benötigen beim Silent Angel einen zweiten Medienkonverter und ein zusätzliches Stück LAN-Kabel. Das ist schade und das kann man besser lösen.
Besonderheiten der Innereien?
Silent Angel weist gerne darauf hin, dass sie mit dem Bonn NX ein eigenes Heimnetz aufbauen, was somit vom normalen Heim-Datennetz vollständig getrennt wird, ohne deshalb gleich mit einem zweiten IP-Netz oder ähnlichem zu arbeiten. Genau solche Lösungen mag ich. Hier wird nicht einfach ein “dummer Porterweiterungskasten” mit andersfarbigen Kondensatoren versehen, ohne ihn dadurch auch nur einen Hauch “smarter” zu machen, sondern hier steckt wirklich Gehirnschmalz in diesem Switch. Genau so, wie es ja auch beim Melco, Innuos oder SotM der Fall ist.
Die Mitbewerber
Wo wir doch schon dabei sind, über die Mitbewerber zu sprechen.
Wo will sich der Silent Angel Bonn NX eigentlich einordnen?
Laut Silent Angel soll er an die Spitze. Ganz nach oben!
… was ihm preislich schon mal nicht gelingt.
Ein Melco S10 kostet fast das Doppelte. Der hat dann aber auch einen SFP.
… dafür allerdings keinen Anschluss für eine Masterclock.
Der SotM sNH-10G CLK, der bietet uns als einziger audiophiler Switch beides. Den SFP und den BNC-Anschluss für die Masterclock. Und das bei standardisierten 10MHz, wodurch er sich sowohl an die hauseigene Masterclock anschließen lasst, als auch an den MUTEC REF10 SE120 und natürlich auch an andere Masterclocks verschiedener Hersteller. Sogar an die Masterclock von Soulnote, die nur einen einzelnen Anschluss bietet und das Ganze dann damit etwas dekadent wirken lässt. 🙂
Egal, wie sich der Bonn NX also später beim Hörtest schlagen wird, der SotM mit CLK-Anschluss wird in puncto Flexibilität und Ausstattung die Nase vorne behalten. Und klanglich ist mir bisher – zumindest im Zusammenspiel mit einer externen Masterclock noch nichts ähnliches unter gekommen.
Der InnuOS PhönixNet bietet überhaupt nichts von alledem. Dort scheint man der Meinung zu sein, auch ohne diesen “ganzen Quatsch” ein hervorragendes Klangbild liefern zu können. Was man ihm auch nur bescheinigen kann.
Der König ist tot, es lebe der König?
Schafft es nun also der Silent Angel Bonn NX, sich an allen Mitbewerbern vorbei an die Spitze der audiophilen Switches zu schieben?
Bisher …
teilten sich drei Switches die Spitzenposition:
Der InnuOS PhönixNet ist der Switch mit der besten Dynamik und Lebendigkeit.
Der Melco S100 und auch der S10 sind beim Thema “Ruhe im Klangbild” nicht zu schlagen.
Der SotM sNH-10G reiht sich ohne Masterclock hinter dem Melco und hinter dem InnuOS ein, zieht aber ganz locker an beiden vorbei, wenn man ihm denn eine Masterclock zur Seite stellt.
… was natürlich auch den Preis deutlich in die Höhe schießen läßt.
Nachdem ich nun den Bonn NX hören konnte, kommt Bewegung in meine Rangliste.
Der Silent Angel Bonn NX zieht bei der Dynamik und Lebendigkeit mindestens mit dem InnuOS gleich, in puncto Ruhe gesellt er sich auf Augenhöhe zu den beiden Switches von Melco und im Gesamtergebnis landet er auf ähnlichem Klang-Niveau, auf dem der SotM sNH-10G auf ihn wartet, wenn der denn von einer Masterclock versorgt wird.
Was die Frage erzeugt, wie denn der Bonn NX wohl klingen wird, wenn auch er seinen Takt über eine externe Masterclock bezieht. Da es sie noch nicht gibt und meine vorhandenen Clocks allesamt nicht passen, muss ich Ihnen die Antwort noch schuldig bleiben.
Hörtest
Also geht es heute erst einmal darum, den Silent Angel Bonn NX mit der eingebauten Clock zu hören. Und ich beginne auch konsequent mit dem internen Netzteil.
Ausgiebige Tests mit verschiedenen externen Netzteilen werden bald folgen.
Natürlich beginne ich wie so oft mit “Keith don`t go” von Nils Lofgren.
Und nach den ersten 5 Tönen (!!) steht bereits fest:
An diese Dynamik und Präsenz kommt selbst ein Innuos nicht ganz heran. Sorry Innuos, aber den Spitzenplatz im Bezug auf Dynamik und Lebendigkeit bist Du definitiv los.
Die Membranen meiner Progressive Audio Extreme III werden mit einem so ungewohnten Druck und mit einer derart souveränen Kontrolle in Schwingungen versetzt, dass man glauben könnte, man hätte sich einen neuen Verstärker gegönnt.
Tatsächlich habe ich aber nur den Switch getauscht.
Angesichts der Tatsache, dass Innuos den Preis des PhönixNet mittlerweile auf 3.099,- € angehoben hat, wird der es künftig sicher schwer haben, sich gegen den Bonn NX durchzusetzen.
Ich wechsle zu “Spanish Harlem” von Rebecca Pidgeon, ein extrem ruhig vorgetragener Titel.
Und hier wird nun auch der Rang des Melco in Frage gestellt. Die Ruhe im Hintergrund beherrscht der Bonn NX genau so perfekt wie die beiden Melco-Switches.
Und statt neugierig zum nächsten Titel zu wechseln, bleibe ich hier noch ein wenig bei diesem Lied hängen.
Was hat diese Rebecca da nur für eine neuartige Stimme?
Ich dachte immer, man hätte das Mikrofon vielleicht ein wenig weiter wegstellen können. Immer klang die Stimme ein klein wenig “überladen”.
Heute höre ich eine junge Sängerin und nichts lässt mich daran zweifeln, dass ich mich in diesem Aufnahmeraum befinde und diese Stimme direkt vor mir höre.
Eben nicht über Lautsprecher.
So, als würde mich Rebecca Pidgeon ansehen und nur für mich singen.
Gänsehaut pur.
Sie singt auch nicht einfach nur “grows” wie sie sonst dieses “grows” gesungen hat.
Bei “I beg your Pardon” höre ich dieses “beg” – ein kurzes Wort. Und doch liegt heute mehr Ausdruck in diesem Wort. Es ist nicht einfach ein kurz gesprochener Vokal, fast steckt eine Melodie in ihm.
Ich starte “O Helga Natt” von Cantate Domino.
Eine Aufnahme, die ich gerne zur Adventszeit in mein Vorführ-Repertoire aufnehme.
Heute habe ich den Eindruck, dass die Mikrofone doch an einer anderen Stelle gestanden haben.
Kurz und gut:
Man entdeckt mit dem Bonn NX seine Stücke neu. Und nichts lässt mich glauben, dass es vorher “richtiger” gewesen sein könnte.
Und? Ist der Bonn NX nun der beste Switch, den man derzeit kaufen kann?
Das wichtigste Attribut des Besten ist, im Vergleich zu den Guten noch ein klein wenig herausstechen zu können. Die Guten bleiben gut, aber der Bessere ist halt noch ein Stückchen besser.
Wobei man das jetzt natürlich etwas relativieren muss.
Wie Sie bei mir schon mehrfach gelesen haben, spielen Ausstattungen wie ein SFP-Port für ein Glasfaserkabel oder eine Buchse für die externe Masterclock auch klanglich eine große Bedeutung. Je nach gesetztem Schwerpunkt kann also die Entscheidung möglicherweise von Ihnen auch anders getroffen werden.
Vorteile des NX:
Die neue Klangreferenz. (Bei Betrieb ohne Masterclock)
Edles Design und eine traumhafte Verarbeitung.
Anschluss für eine externe Masterclock (25MHz)
Nachteile des NX:
Hochpreisig.
Masterclock-Anschluss nicht im 10MHz-Standard-Format.
Kein SFP (Glasfaseranschluss).
Hier geht es zum Produkt. [...]
Lesen Sie weiter ...
28. Mai 2022ProduktberichteAudioQuest Dragon – den Drachen reiten?
AudioQuest Dragon – den Drachen reiten?
In meinem Bericht „AudioQuest Dragon – den Drachen reiten?“ geht es um die neue Kabelserie „Mythical Creatures“ des Herstellers AudioQuest und zwar um die Top-Ausführung.
Ausnahmsweise wird diese Kabelreihe die Szene mal sicher nicht (!) polarisieren. Bei der Beurteilung der aufgerufenen Preise dürfte wohl eine sonst eher selten anzutreffende Einigkeit herrschen.
audioquest Mythical Creatures
Nun ist es nicht so, als würde AudioQuest mit seiner neuen Serie ein bisher nicht erreichtes Preis-Terrain erobern. „Da oben“ warten schon einige. Wie aber definiert AudioQuest die Zielgruppe für ein 1m-XLR-Kabel zum Preis von 11.900,- €?
Oder will AudioQuest dieses Kabel gar nicht wirklich verkaufen, sondern der Szene einfach nur mal zeigen, wozu man klanglich in der Lage ist, wenn der Preis keine Rolle spielt?
Ich selbst muss erst mal eine Weile darüber nachdenken, auf welche Seite ich mich hier schlagen soll. Immerhin höre ich schon seit Jahren mit NF-Kabeln in der 4.000,- €-Klasse und lasse mir diesen Genuss von nichts und niemandem jemals wieder madig machen.
Da müsste man es doch für kleingeistig halten, wenn ausgerechnet ich jetzt irgendwo eine rote Linie ziehe, nach dem Motto:
Bis dahin ist es ok – aber ab da nicht mehr.
Für wen sollte ich da sprechen?
Nein, eine solche Festlegung steht mir nicht zu.
Zumal die Halbwertszeit von roten Linien im HiFi-Bereich erfahrungsgemäß eher kurz ausfallen. Was gestern noch als „viel zu teuer“ galt, hat sich heute etabliert und zählt morgen bereits zum Standard einer HiFi-Kette.
Wer sein persönliches Klangziel erreichen will, der muss lernen, die Hürden zu überwinden, die durch die Meinung anderer aufgestellt werden.
AudioQuest Mythical Creatures
Jeder, der technische Informationen über diese neue Serie sucht, findet auf der Seite https://www.audioquest.com/mythicalcreatures/de-index.html optisch wunderschön aufbereitetes Hintergrundwissen und ich erspare es mir, das hier in eigene Worte zu fassen.
Was genau – erwartet man eigentlich, wenn man auf einmal mit einem 11.900,- € teuren XLR-Kabel in seiner Kette Musik hört?
Soll da plötzlich aus einer billigen Schrömmelgitarre ein spanisches Konzert-Instrument werden?
Soll sich eine Garagen-Aufnahme so anhören, als hätte sie in der Elphi stattgefunden?
Soll eine Suzanne Vega das Stimmvolumen einer Monserrat Caballé erhalten?
Alles Quatsch! Totaler Blödsinn!
Egal – wie viel Geld wir auch immer in unser HiFi-Equipment pumpen –
niemals darf ein künstlich erzeugter Sound zu unserem Ziel werden!
Weder ein übertriebener Bass, noch überzogene Höhen, unnatürlich hohe Lautstärken, Aufnahmeräume wie bei einer Explosionszeichnung oder einzelne Instrumente, die wie mit der akustischen Lupe exponiert dargestellt werden …
… das alles ist Klang-Mist und solche Gelüste sollten vom seriösen HiFi-Markt nicht befriedigt werden.
Wer die High-Fidelity ernst nimmt, der darf nur ein einziges Ziel haben:
Alles soll so wiedergegeben werden, wie es die Musiker geschaffen und der Tonmeister festgehalten hat. Genau so und nicht anders.
Zurück zum AudioQuest Dragon XLR.
Was erwarte ich selber von diesem Kabel?
Ganz ehrlich: Ich kann es gar nicht richtig beschreiben.
Alles, was ich von diesem Kabel fordere, das habe ich doch durch meine bisherige Kabelauswahl längst erreicht.
Es klingt bereits richtig – nicht nach Sound.
Es klingt schon beeindruckend, nicht übertrieben.
Es klingt natürlich – nicht so wie irgend jemand glaubt, dass es klingen muss, damit man es verkaufen kann.
Eines kann ich also schon einmal festhalten:
Es ist ganz sicher kein klanglicher Notstand und keine Unzufriedenheit, die mich zu diesem Kabeltest führen.
Ich habe den höchsten Berg weit und breit erklommen und hier oben gibt es nicht einmal mehr einen Stein oder einen Baum auf den man noch klettern könnte.
Ich bin doch bereits ganz oben!
Der Hörtest
Meine Abhör-Kette ist vorbereitet und das AudioQuest Dragon XLR durfte sich in einer „Radio-Anlage“ bereits etwa eine Woche einspielen. Jetzt hängt es in meiner besten Anlagenkonfiguration.
Ich starte den ersten Titel.
Es ist zufällig „Der Dorftrottel“ von Ludwig Hirsch.
Und?
„So habe ich das noch nie gehört!“.
Wie oft haben wir alle diesen Satz wohl schon ausgesprochen!?
Wie oft haben wir ihn von Freunden gehört, die bei uns Musik hören durften?
Immer und immer wieder hat uns dieser Satz in unserem audiophilen Werdegang begleitet.
Und heute bin ich mir mal wieder sicher:
„So habe ich das noch nie gehört!“.
„Dieser Titel beginnt mit einer Zither! Nicht mit einer Gitarre. Und die Zither liegt da halb links vor dem Musiker. Man kann sie sehen!“.
Ich wechsle zu „One Night While Hunting For Faeries“ von The Flaming Lips.
„Das ist ja gar kein Klick-Geräusch aus dem Synthesizer, da werden ja tatsächlich zwei Klangstäbe aneinander geschlagen.” Solche, wie wir sie noch aus der Grundschule kennen. Orffsche Instrumente nannten die sich wohl.
Und mein Gott, was für ein Frevel.
Da glaubte man bisher, irgend so ein Keyboarder würde so ein künstliches Klicken abrufen und tatsächlich schlägt da ein Musiker Klangstäbe aneinander. Und man hört nicht nur die Klangstäbe, sondern auch den Raum, in dem sich das Klacken ausbreiten kann. Hier werden keine Midi-Files oder Loops abgerufen, hier macht jemand richtige handwerkliche Musik.
Wenn auch „nur“ mit Klangstäben. Wahnsinn!
„Norma, Act 1, Casta Diva“, Maria Callas, Coro del Teatro alla Scala die Milano
Und wo steht denn die Callas da auf einmal? Ich merke, dass ich mir bisher darüber nicht wirklich Gedanken gemacht habe.
Jetzt – steht sie halb links mitten auf einer Opernbühne – innerhalb eines vollständigen Bühnenbildes! Ich schließe meine Augen und bin Zuhörer bei einer echten Opernaufführung.
„Keith don`t go“, Nils Lofgren
Und auch wenn Sie ob der Titel-Auswahl jetzt gleich gedanklich auf mich einschlagen möchten, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich diese Aufnahme mit diesem Kabel mal anzuhören! Dieser Titel hat sich angeblich zum meist gehassten Titel bei HiFi-Messen entwickelt. Einfach deshalb, weil er schon so oft gespielt wurde. Und dennoch – ich oute mich erneut – ich höre ihn immer noch wirklich gerne.
Doch heute geschieht das Unerwartete.
Heute sitze ich da und sage erneut:
„So habe ich das noch nie gehört!“.
Ich starte „Death Scene“ von Chuck Mangiones „Children of Sanchez“ und endlich steht das Cello mal tatsächlich zweifelsfrei auf dem Boden.
In „Falling Slowly“ von Glen Hansard und Marketa Irglowa ist es beeindruckend. wie Glen Hansard nach einer stimmlichen Dominanz immer wieder zu einer zurückhaltenden Phase wechselt, um eine traumhafte Harmonie mit der zarten Stimme der Irglowa einzugehen.
„So habe ich das noch nie gehört!“.
Nach etwa 3 Stunden Playlists rauf und runter hören, komme ich zu folgendem Ergebnis:
Hier steht nicht die Frage im Raum, ob das Dragon irgendwas – irgendwie „besser“ darstellt.
Dieses AudioQuest Dragon hebt das bisher Mögliche auf eine neue Stufe!
Ich habe auch schon vor diesem Kabel ganz ganz oben auf einem Berg gestanden und es ging wirklich nicht mehr höher hinauf.
Doch ab sofort …
nenne ich einen Drachen mein Eigen.
Mein Fazit:
Der Wert eines Produkts wird definiert durch seine Qualität.
Die Verkaufbarkeit ergibt sich im Markt-Vergleich von ganz alleine.
AudioQuest geht mit dem Dragon einen neuen Weg und nimmt derzeit aus meiner Sicht eine klangliche Spitzenstellung ein.
Diese Kabelserie erfüllt allerhöchste Klangansprüche und zeigt auf, was heute technisch realisierbar ist und wo bisherige Kabelkonstruktionen noch Schwächen aufweisen.
Bleibt zu hoffen, dass die Mythical Creatures-Serie Augen öffnet, Lösungswege aufzeigt und kreative Ideen entstehen lässt.
… um uns eines Tages ähnliche Ergebnisse zu einem angenehmeren Preis zu bescheren.
Manchmal geht es eben auch dann noch höher, wenn man schon ganz oben ist.
… und wenn man dafür auf einen Drachen steigen muss.
Hier geht es zu den Angeboten: Hier klicken [...]
Lesen Sie weiter ...
3) Aktuelle Shop-Produkte
2) Aktuelle Shop-Produkte
Doepke DFS Audio – audiophiler Fi23. April 2024Doepke DFS Audio – audiophiler Fi
Den Sicherungsautomaten gegen eine audiophile Ausführung auszutauschen ist nur der erste Schritt.
Lesen Sie hier mehr darüber, wieso Sie auch den Fehlerstrom-Schutzschalter austauschen sollten:
Bericht folgt.
Hier im Angebot:
Doepke Fehlerstromschutzschalter DFS Audio …
Version 1: DFS 2 – 40A
Sichert die eine (!) Phase, die Sie für Ihre HiFi-Anlage nutzen.
Version 2: DFS 4 – 63A und DFS 4 – 63A -R
Sichert alle drei (!) Phasen Ihrer Installation.
(Falls Sie keine zwei verschiedenen Fi verwenden wollen oder wenn Sie an mehreren Steckdosen im Haus HiFi-Geräte anschließen möchten.)
-R heißt: Null-Leiter rechts – fragen Sie Ihren Elektriker, was er leichter montieren kann. [...]
Weiterlesen...
Baaske Medical Netzwerkisolator19. Februar 2024Baaske Medical Netzwerkisolator
Baaske Medical Netzwerkisolator
Der Baaske Medical Netzwerkisolator wurde zum Schutz der Patienten in medizinischen Einrichtungen entwickelt. Dort, wo das öffentliche Stromnetz, die Internetverbindungen unserer Provider (WAN), unsere lokalen Netzwerke (LAN) und die Arbeitsströme verschiedener medizinischer Geräte aufeinander treffen, sind Leib und Leben der Patienten gefährdet.
Der Netzwerkisolater MI 2005 löst jetzt das vorherige Modell MI 1005 ab und ist sowohl leistungsfähiger als sein Vorgänger (Datenübertragung) als auch sicherer bei der Trennung der Netze.
Wir Musikliebhaber leben zwar in der Regel keineswegs in einer solch gefährlichen Umgebung, aber den Nutzen einer galvanischen Trennung zwischen unserem Heimnetz und dem öffentlichen Netz, den ziehen wir schon gerne aus solch einem Instrument.
Selbst mit den besten LAN-Kabeln will es bei Ihnen nicht so richtig gut klingen?
Kann es sein, dass das Zusammentreffen der Netze in Ihrem Haushalt die Ursache dafür bildet?
Dann ist es klar, dass Ihnen auch das teuerste und beste LAN-Kabel keinen Klanggenuss liefern kann.
Mit einem MI 2005 von Baaske Medical sorgen Sie für eine hervorragende galvanische Trennung, ohne gleich mehrere Hundert Euro für eine aus dem audiophilen Bereich stammende Lösung ausgeben zu müssen. (… die ja auch nur galvanisch trennen soll)
Wohin gehört der Netzwerkisolator in einer HiFi-Kette?
Hier eine Empfehlung zur Konstellation:
Router (Fritz!box …)
Audiophiles LAN-Kabel (wir empfehlen Furutech LAN8 NCF)
Baaske Medical MI 2005
Audiophiles LAN-Kabel (wir empfehlen Furutech LAN8 NCF)
Audiophiler Switch (siehe Kategorie “Audiophile Switches“)
Audiophiles LAN-Kabel (wir empfehlen Furutech LAN8 NCF)
Streaming-Komponente (wir empfehlen PrimeCore Audio®)
Zum Produktbericht hier klicken. [...]
Weiterlesen...
PrimeCore Audio® Streamer A5/A714. Dezember 2023PrimeCore Audio® Streamer A5/A7
Streamen mit dem PrimeCore Audio® –
weil Roon es verdient hat!
Mit einem PrimeCore Audio Streamer A5 oder A7 haben Sie eine innovative Hardware-Lösung für einen Roon-Core-Server gefunden.
Ein PrimeCore Audio®-Streamer ist alles in einem:
* Roon-Core-Server,
* Streamer und
* Renderer.
Sie benötigen nur noch einen Digital-Analog-Wandler oder ein Roon-Ready-Gerät – fertig!
Entdecken Sie weitere Informationen in unserem PrimeCore Audio-Spezial. Hier klicken!
TEST BEI HIFISTATEMENT:
(auf das Bild klicken oder hier auf diesen LINK )
Schauen Sie hier ein Video von unserem Partner Markus Wierl (audio-freak):
Hier klicken, um zum Video zu gelangen!
ACHTUNG! Sie werden nach Youtube weitergeleitet!!
Wer braucht einen A5 und wer einen A7?
Der A5 ist der preisgünstige Einstieg in die PrimeCore-Audio®-Welt und steht der A7-Lösung qualitativ in nichts nach. Die Bauteile sind ein wenig günstiger und das geben wir an unsere Kunden weiter.
Klanglich liegen beide ziemlich gleich auf, wobei der A5 oft als etwas “analoger” beschrieben wird.
In der Nutzung gibt es beim A5 keinerlei Einschränkungen. Alles was der A7 kann, das kann der A5 ebenso. Nur ein A3 mit Intel i3-Prozessor würde einigen Einschränkungen unterliegen, weshalb wir ihn bei PrimeCore Audio® auch nicht einsetzen.
Lieferumfang:
1x PrimeCore Audio®-Server A5/A7 je nach Bestellung
1x Ausreichend dimensioniertes Schaltnetzteil
1x Ausführliche Bedienungsanleitung
Kundenstimmen zum PrimeCore Audio®-Streamer (hier klicken)
Audiophiles Netzteil gewünscht?
Zurzeit können wir folgende Netzteile sicher empfehlen:
Progressive Audio PCA 19V/6A Special-Edition
Keces P8 Single 19V/8A
Keces P14
Keces P28
Wenn keine externen Geräte über den Streamer mit Strom versorgt werden müssen (Festplatten, Monitore …) funktioniert auch das Keces P8 Dual mit 19V !!
P3 und P6 sind nicht geeignet. [...]
Weiterlesen...
Keces P14 – High-End-Linear-Netzteil für bis zu 4 Geräte30. Juli 2023Keces P14 – High-End-Linear-Netzteil für bis zu 4 Geräte
Das ultimative Linear-Netzteil für den anspruchsvollen Musikliebhaber.
Mit dem neuen P14 betreiben Sie bis zu 4 DC-Geräte.
Das spart: 3 Netzteile, 3 Stromkabel und 3 Steckdosen!
Zone I: 5V/7V/9V/12V, 4A
Zone II: 12V/15V/19V/24V, 6A
Zone III: 5V/9V, 2A
Zone IV: USB 5V, 2A
High Quality Toroidal Transformer provide pure power.
Separate ground for each output rail.
Ultra low ripple noise.
No humming or buzz noise for 50Hz and peak load.
Newly designed the Circuit that do not use any ICs. It is truly Analog design.
Quantum Resonance technology „that provides a subtle field that makes all electromechanical components resonate in unison to improve coherence and timing.“
There are 6 zone and each zone are separated.
USB Isolator for audiophile grade systems.
New in-house Audio Grade foot cone.
Ripple Noise <100uV bei Volllast <10uV at 60% Last
Gehäuse Vollaluminium – Abmessungen (BxTxH) 300 x 279 x 66 mm [...]
Weiterlesen...
Audioquest Diamond USB-Kabel A/B30. Juli 2023Audioquest Diamond USB-Kabel A/B
Seit etwa 8 Jahren ist dieses USB-Kabel unsere Klang-Referenz.
“Irgendwo in den Weiten des Weltalls” mag es ein USB-Kabel geben, was dann zum zigfachen Preis noch einmal eine Spur besser klingt, aber ein Kabel zum akzeptierbaren Preis, was das Diamond deklassiert, habe ich bisher nicht gefunden.
Der Preis mag einem zunächst unberechtigt hoch erscheinen – wenn man dann aber eine monatelange Suche hinter sich hat und mit den eigenen Ohren hören konnte, welchen Klangvorsprung dieses Kabel hat, dann muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, dass dieses USB-Kabel sein Geld wert ist.
Auch wenn es anfangs weh tut. [...]
Weiterlesen...
SupraCables USB Excalibur30. Juli 2023SupraCables USB Excalibur
Ich mache kein Geheimnis daraus, dass mein Lieblings-USB-Kabel immer noch das Audioquest Diamond ist. Aber nicht immer darf/kann es ein Kabel für über 700,- € sein und die preisgünstigeren Audioquest-Kabel schaffen es dann nicht, sich deutlich vom SupraCables Excalibur abzusetzen.
Deshalb ist dieses SupraCable unser Preis-/Klangtipp!
USB 2.0 High Speed – Excalibur
Excalibur ist ein Premium-Hochgeschwindigkeitskabel mit verbesserter Daten- und Stromübertragung. Sowohl das Datenpaar als auch das Leistungspaar sind für ihren Zweck optimiert. Das verdrillte Datenpaar besteht aus PE-isoliertem, versilbertem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Silberschicht ist sehr dick, 3,8 % der Gesamtfläche, für beste Leitfähigkeit und hohen Geschwindigkeitsfaktor. Die Versilberung macht den Leiter gut für hohe Frequenzen und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Der Aufbau der Leiter ist im Vergleich zum Datenpaar völlig anders. Um Stromverluste zu minimieren und die Drahtfläche zu maximieren, haben wir vier verzinnte Leiter in einer Sternviererkonfiguration verwendet. Star Quad Twist zusammen mit den separaten Abschirmungen reduziert effektiv alle RFI. Das Design der Anschlüsse folgt dem gleichen Designkonzept wie unsere beliebten demontierbaren HDMI-Anschlüsse. Die Kontakte sind vollständig in Aluminium geschirmt. Die Anschlüsse sind abnehmbar, damit das Kabel durch einen 16-mm-VP-Schlauch geführt werden kann, es wird nur ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Bei der Installation in Rohren sind keine erweiterten Montage-/Lötarbeiten erforderlich, die die Leistung des Supra beeinträchtigen könnten.
SUPRA USB 2.0 Excalibur High Speed
2×0,24mm2/AWG 23 versilbertes Kupfer
2x19x0,127 – PE isoliert
4×0,24mm2/AWG 23 verzinntes Kupfer
4x19x0,127 – PE isoliert Geschirmtes Twisted-Pair, ALU/PET-Folie + Bileiter
PVC GA74 Crystal,
rund. Durchmesser: 7,3 mm
Transparentes Eisblau
Vergoldete Kupferstifte. Aluminiumabdeckung
Karton 17x16x4 cm
480+ Mbit/s
52 Ohm/km
45 pF/m
90 Ohm
0,66 x C (Lichtgeschwindigkeit) [...]
Weiterlesen...
Keces S3 Kopfhörerverstärker29. Juli 2023Keces S3 Kopfhörerverstärker
Zum Bericht bei sempre-audio.at
[...]
Weiterlesen...
Ferrum OOR29. Juli 2023Ferrum OOR
Mit Ferrum-eigener Verstärkungstechnologie sowie seiner kraftvoll-luftigen Wiedergabe treibt der OOR jeden Kopfhörer mühelos zu klanglicher Spitzenleistung.
Zum Testbericht bei hifistatement [...]
Weiterlesen...
Matrix X-SPDIF 229. Juli 2023Matrix X-SPDIF
Der Matrix X-SPDIF 2 ist ein kleiner, digitaler “Tausendsassa”, der sich vor allem um eine Verbesserung der USB-Signale kümmert, aber am Ende auch zu einem “Adapter” von USB auf alle diverse Anschlüsse wird.
Zur Vertriebsseite wechseln
Zum ausführlichen Testbericht bei HiFistatement [...]
Weiterlesen...
ADOT Transceiver (SFP)22. April 2023ADOT Transceiver (SFP)
ADOT Transceiver (SFP)
Zusatz- oder Ersatz-Transceiver.
Auch geeignet, um IT-Geräte mit einer audiophileren Schnittstelle auszustatten.
Achten Sie darauf, den/die richtigen Transceiver zu bestellen. Multimode- und Singlemode-Transceiver sind auf das verwendete Kabel angepasst.
Bei einem Upgrade von Multimode- auf Singlemode-Kabel sind zwingend die passenden Single-Mode-Transceiver mitzubestellen.
Angebot – Upgrade-Kit
Das Singlemode-Upgrade-Kit besteht aus 2x Singlemode-Transceiver und 1x 1,5m Singlemode-Glasfaser. [...]
Weiterlesen...
4) Aktuelle Handbuch-Artikel
3) Aktuelle Handbuch-Artikel
12. November 2022HiFi-Handbuch / Roon-Spezial / StreamingDas audiophile Heimnetz
Das audiophile Heimnetz
Aktualisiert am 11.11.2022
Im Bericht „Das audiophile Heimnetz“ geht es heute um die Betrachtung unserer heimischen LAN- und WLAN-Netzwerke aus Sicht eines Musikliebhabers und um die Frage, wie wir die darin verborgenen klanglichen “Flaschenhälse” beseitigen können, um endlich in die High-Resolution-Audio-Streaming-Welt eintauchen zu können.
Unter anderem wird es gehen um:
Austausch der TAE-Dose gegen eine RJ45-LAN-DoseAustausch des TAE-Anschlusskabels zum Router gegen ein LAN-KabelAustausch des Netzteils für den RouterLAN-Kabel vs. WLAN vs. PowerLANGlasfaser als Inhouse-VerkabelungAudiophile SwitchesGetrennte Netze (VLANs)Masterclocks
Viel Spaß beim Lesen!
Heimnetze
Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Muttis Einkaufsnetze so ziemlich die einzigen Netze, die wir zuhause verwendet haben.
Heimnetzplanung
Das änderte sich, als das Internet bei uns einzog und immer mehr Geräte in unserem Haushalt daran angeschlossen werden wollten.
Heute tut man bei einem Neubau oder einer Renovierung gut daran, nicht nur an einer (!) passenden Stelle für einen Anschluss an das Internet zu sorgen.
Und vor allem die HiFi-Anlage! sollten wir dabei nicht vergessen.Denn die Musik von Morgen – die kommt ganz sicher aus dem Internet.Und für alle die, die es noch nicht wahrhaben wollen:
Die Zukunft ist längst da!
Wer nun allerdings glaubt, er könne Klangrekorde brechen, indem er sich einfach eine Streaming-Komponente kauft und sie mit den vorhandenen Kabeln an den Router anschließt, der irrt sich ganz gewaltig.Auch das Testen eines Streamers/Roon-Core-Servers, ohne sich vorher um das Heimnetz gekümmert zu haben, kann nur in die Hose gehen.
Leute – solch einen Test könnt Ihr Euch wirklich sparen!
Würde sich jemand eine Fotokamera kaufen, den Opjektivdeckel nicht abmachen und dann über die viel zu dunklen Bilder (bei so einer teuren Kamera!) meckern, würde das doch auch niemand auf die Kamera schieben, oder?
Wer zukünftig nicht (!) mehr länger zu denen gehören will, die Streaming für eine klangliche Katastrophe halten und nach wie vor behaupten, CD würde besser klingen, der muss sich nur die Fakten genauer anschauen und kommt dann ganz von alleine darauf, was er zu tun hat.
… das Heimnetz optimieren!
Wer das nicht glaubt, der sollte besser bei der CD bleiben. Ich hätte da noch etwa 2.000 Stück zu je 1,- € abzugeben!
Und dabei muss die Optimierung überhaupt keine Unsummen kosten.Schon unser Klangtipp-LAN-Kabel für etwa 5,- € verbessert die klangliche Situation erheblich.Dass viele unserer Kunden nach dem Test dieses Kabels „klang-süchtig“ werden und dann plötzlich bereit sind, noch viel mehr in das Heimnetz zu investieren, das spricht doch für sich, oder?
Wo holt sich so ein Streamer die Musik denn her?
Natürlich von einem Musik-Portal.Und davon haben wir mittlerweile eine ganze Menge.
Viele dieser Portale – wie der Platzhirsch Spotify – liefern die Titel nur im MP3-Format aus. Das ist für unterwegs ideal (verbraucht wenig Datenvolumen) und wer keine tolle HiFi-Anlage besitzt, der kommt mit dieser Qualität sicher auch zuhause zurecht.
High-Fidelity … ist das aber nicht!
Wer mehr Wert auf die Klangqualität legt, der sollte sich unbedingt mal bei highresaudio.com umsehen.Wer sich neben einer guten Qualität auch eine große Titelauswahl wünscht, der findet sicher mit Qobuz oder Tidal den richtigen Anbieter.
Kommen wir zur Technik.
Unser Hausanschluss
TAE-Dose
Den Zugang zu unserem Haus finden diese Portale natürlich über unseren Telefonanschluss. In der Regel handelt es sich dabei um eine TAE-Dose. TAE steht hier für Telekommunikations-Anschluss-Einheit.
Diese Dose ist an sich ja ganz ok.
Fritzboxkabel
Was uns HiFi-Freaks mehr stört, ist die miese Klangqualität des Kabels das zum Router führt. Leider hat sich noch kein Kabelhersteller erbarmt und uns ein audiophiles TAE-Kabel präsentiert. Dann nämlich könnten wir uns den Umbau sparen.
Aber so schlimm ist das auch wieder nicht, denn auf dem Gebiet der Ethernetkabel sieht das mittlerweile ganz anders aus. Zwischen 5,- € und 5.000,- € pro Meter bietet der Markt hier für jeden Geschmack und Geldbeutel eine ausreichend große Auswahl.
TAE passt nicht für RJ45
Um das TAE-Kabel gegen ein LAN-Kabel tauschen zu können, brauchen wir aber eine andere Anschlussbuchse, denn der RJ45-Stecker passt logischerweise nicht in die TAE-Dose.
Das einfachste wäre hier ein Adapter von TAE auf Ethernet und zum Testen ist das auch wunderbar.
Gefällt uns das Ergebnis dann, können wir die TAE-Dose später immer noch gegen eine Ethernetdose austauschen.
Die beiden Adern vom Telefonkabel, die stecken wir dann in die Klemmen “4” und “5”.
Ethernetdose einfach verschaltet
Aber testen Sie ruhig mal, welches der beiden Adern in 4 und welches in 5 soll. Hier und da führt der Wechsel zu nicht erklärbaren Klangunterschieden.
Ethernetdose kreuzverschaltet
Tipp (siehe Bild oben):Wenn die Adern lang genug sind, legen Sie sich am besten eine Doppeldose zu. Dann können Sie mit dem ersten Kabel zunächst in die Klemme 4 vom ersten Anschluss gehen und dann weiter zur Klemme 5 von der zweiten Dose. Mit dem zweiten Kabel verfahren sie andersherum, gehen also erst nach Klemme 5 und in der zweiten Dose nach Klemme 4.
RJ45-Kabel in Dose
So brauchen Sie das LAN-Kabel einfach nur abwechselnd in die eine oder in die andere Dose zu stecken und können sich die Ergebnisse anhören.Hören Sie keinen Unterschied, ist es auch egal, in welcher Dose das Kabel stecken bleibt.Dieser Tipp kostet nichts – sorgt aber für Sicherheit.
Das Kabel zum Router
Ist die Dose fertig montiert, können wir endlich ein gutes (!) LAN-Kabel von der Dose zum Router ziehen. Doch wie gut sollte das LAN-Kabel eigentlich sein?
Wir haben hier folgende Empfehlungen:
Echt billig – aber trotzdem gut: FS-COM Klangtipp-LAN-Kabel (ab 5,- €)Richtig gut – aber gar nicht teuer: Furutech LAN 8 NCF (ab 166,- €)Lange Zeit unsere Referenz gewesen: Audioquest Diamond (ab 998,- €)
Unsere Empfehlung geht also klar hin zum Furutech LAN8 NCF. Sowohl preislich als auch klanglich.
Der Router
Fritz!Box
Gerne würde ich Ihnen da jetzt so einen richtig audiophilen, sündhaft teuren Router vorschlagen, der klanglich alles schlägt, was weit und breit als Konkurrenz auftaucht. Aber das könnte ich nicht mit ruhigem Gewissen tun.Deshalb geht mein Tipp ganz einfach heute zur aktuellen Fritz!Box 7590 AX von AVM.
Und wenn gar keine TAE da ist?
Wer einen Kabelanschluss hat, der hat auch keine TAE-Dose. Bei ihm kommt ein Coax-Kabel am Router an. So ein Coaxkabel ist so etwas wie ein Antennenkabel und auch die gibt es natürlich in einer besseren Ausführung. Aber leider habe ich da keinerlei Erfahrung und kann Ihnen deshalb auch keinen Kabel-Tipp geben.
Ähnliches gilt für diejenigen, die gar keine Kabelverbindung zum Provider haben, sondern den Anschluss über LTE regeln. Wo kein Kabel ist, kann man logischerweise auch nichts tauschen.
Das audiophile Netzteil für den Router
Auch wenn Sie diese Aussage für völligen Quatsch halten – diese Ausgabe lohnt sich doppelt und dreifach!
sbooster
Sollten Sie an dieser Stelle nur den Router mit Strom versorgen müssen, dann reicht ein Sbooster von BOTW. Er ist der günstigste Stromversorger unter den audiophilen. Das Ziel ist, die Störungen durch das mitgelieferte Billig-Schaltnetzteil zu eliminieren und das schafft ein Sbooster wirklich ausgezeichnet.
Keces P6 vorne
Sollten Sie noch ein weiteres Gerät versorgen müssen – zum Beispiel einen Medienkonverter – dann lohnt sich der Griff zum Keces P6. Dieses Teil hat zwei Ausgänge, die dazu noch in recht großen Bereichen anpassbar sind, sodass wir es ganz sicher nach einem Komponentenwechsel auch für die neuen Geräte noch gut gebrauchen können.
Und gönnen Sie dem Netzteil ruhig auch ein gutes Stromkabel!Testen Sie einfach mal ein paar Kabel – Sie werden es nicht glauben, was da klanglich passiert.Selbst an dem Netzteil für den Router!
Tipp:Und wenn wir schon dabei sind:Tauschen Sie doch auch mal die Steckdose aus. Nicht nur an dieser Stelle! Aber wählen Sie bitte nicht aus Kostengründen eine von diesen preiswerten, halbherzigen „Schönfärber-Dosen“, die die ganze schöne Dynamik, die die Fritz!Box durch das Netzteil dazu gewonnen hat wieder zunichte machen würden.Greifen Sie zur besten Steckdose auf dem Markt, zur rhodinierten Dose von Furutech – am besten gleich zu der mit NCF!
Wo sollte die Fritz!Box stehen?
So dicht wie möglich bei der Anlage? So weit weg wie möglich?
Nun – in der Regel – werden Sie den Standort wohl weniger nach klanglichen Aspekten festlegen können, sondern Sie werden vermutlich danach handeln, dass die WLAN- und die DECT-Reichweite ausreichen, um Ihr Haus oder Ihre Wohnung optimal versorgen zu können.Das ist auch völlig in Ordnung und stört überhaupt nicht. Im Gegenteil – da so ein Router ein mächtiger Sender ist, kommt es dem Klang eher zugute, wenn er mindestens 3m von der Anlage entfernt steht.Was natürlich auch für einen Repeater gilt!
Glück und Glas, wie leicht …
Was halten Sie eigentlich von einer Glasfaserverbindung?Nein!Ich meine jetzt nicht den Anschluss Ihres Providers, sondern ich rede hier von der Verkabelung zwischen dem Router und der HiFi-Anlage.
ADOT MK Eingänge mit gestecktem Transceiver
ADOT, eine Tochterfirma von Melco bietet uns seit einigen Monaten ein audiophiles System an, was mehr als nur eine Notlösung darstellt. In den meisten Fällen führt dieser Umstieg vom LAN-Kabel auf LWL zu einer weiteren, deutlichen Klangverbesserung.
ADOT Konverter
Da es noch keine Fritz!Box mit LWL-Ausgangsbuchse gibt, setzen wir ein kurzes Ethernetkabel ein, dann folgt der Medienkonverter. Der lange Weg zwischen dem Router und der Anlage, den führen wir dann mit dem Glasfaserkabel aus. Treffen wir dort auf einen Empfänger ohne SFP (Eingang für das Glasfaserkabel), benötigen wir auch hier wieder einen Medienkonverter und ein kurzes LAN-Kabel. Anders sieht das aus, wenn unser Switch bereits selbst über einen Glasfasereingang )SFP) verfügt.
MELCO-S100 SFP
Tipp:Wenn Sie vorhaben sollten, sich auch einen audiophilen Switch zuzulegen, dann denken Sie doch mal über den SotM sNH-10G nach! Er kostet zwar mehr als z.B. ein Bonn N8 von Silent Angel. Wenn Sie aber die 349,- € für den zweiten Medienkonverter plus die 166,- € für das zweite kurze LAN-Kabel berücksichtigen, kommen Sie auf den selben Preis. Und ich kann Ihnen versichern, dass die SotM Lösung hierbei die Nase vorn hat. Dasselbe gilt natürlich auch für den Melco S100, der aber dann preislich schon in einer ganz anderen Liga spielt.Noch ein Tipp:Durch das Angebot „DUAL“ von ADOT sparen Sie zusätzlich!
Der audiophile Switch
Sie werden sich denken können, dass es sich bei der am meisten gestellten Frage um diese hier handelt:
„Wieso sollte ich einen Switch einsetzen, wenn ich nur ein einziges Gerät daran betreiben will?“
Das kommt daher, dass Switches im IT-Bereich vor allem Port-Erweiterungen sind. Wir haben nur vier Buchsen, wollen aber acht Geräte anschließen? Also brauchen wir einen Switch, der uns mehr Anschlussmöglichkeiten bietet.
Und diese einfachen Switches von Netgear, D-Link und Co. machen denn auch nichts anderes, als zusätzliche Ports zur Verfügung zu stellen. Technisch gesehen, sind es „dumme“ Verteiler, die alles was ankommt an alle Ausgänge weiterleiten. Mehr können die nicht.
Silent Angel N16 LPS
Wer einen Anspruch darauf erheben will, seinem Switch die Bezeichnung „audiophil“ aufdrücken zu dürfen, der muss sich schon ein wenig mehr einfallen lassen, als in einem „dummen“ Billigteil ein paar Kondensatoren auszutauschen oder ihm ein besseres Netzteil zu verpassen.
Das Geheimnis eines audiophilen Switches liegt in seiner Konfigurationsmöglichkeit (also im Managen). Um managebar zu sein, muss er über die entsprechende Intelligenz verfügen. Und damit jetzt nicht jeder zuhause wild drauflos managen muss, sollten die notwendigen Einstellungen natürlich bereits vom Hersteller unveränderlich vorgenommen worden sein.
In Firmen kommt man gar nicht umhin, auf solche Switches zurück zu greifen und einen Administrator einzustellen. Der sorgt mit den richtigen Einstellungen dafür, dass zum Beispiel das Leistungsmerkmal „Telefonie“ Vorrang hat. Sollte also gerade eine aufwändige Datensicherung im Netz laufen, so wird sie sofort unterbrochen oder gedrosselt, wenn die Netz-Kapazitäten fürs Telefonieren nicht mehr ausreichen würden.
Im HiFi-Bereich liegen die Prioritäten natürlich an ganz anderer Stelle.Melco zum Beispiel verfährt (unter anderem) nach folgender Philosophie:
MELCO-S100 hinten
Alles, was im Netz verschickt wird – also alle Daten – werden nach dem OSI-Schichtenmodell in kleine Pakete zerteilt und dann getrennt voneinander verschickt. Damit man weiß was drin ist und die Pakete am Ende wieder richtig zusammensetzen kann, bekommt jedes Paket einen „Aufkleber“ mit den beschreibenden Informationen.
Melco sorgt nun dafür, dass zu den audiophilen Ausgängen ausschließlich Pakete geleitet werden, in denen Musiksignale stecken. Alle anderen Pakete und Signale werden geblockt.Ein toller Nebeneffekt liegt darin, dass elektronisches Rauschen und andere Störungen ja von niemandem einen Aufkleber bekommen haben – und deshalb beim Melco-Switch auch nicht weitergeleitet werden.
Ob man diesen Aussagen so folgen möchte oder sie für Werbegeplapper hält, spielt am Ende überhaupt keine Rolle. Tatsache ist, dass das Klangbild durch einen Melco-Switch so sehr an Ruhe und Souveränität gewinnt wie mit keinem anderen Switch.
In unserem Portfolio finden Sie Switches von Silent Angel, English Electric, SotM, Melco und Innuos.
Tipp:Überlegen Sie sich unbedingt vor dem Switchkauf, wie dieser ausgestattet sein soll.Wir führen auch Switches mit LWL-Eingang oder BNC-Buchse für die Masterclock.Beides bringt klangliche Vorteile mit sich, aber lediglich der große SotM bietet uns beide Ausstattungsvarianten in einem Gerät.
Fassen wir unsere Erkenntnisse an dieser Stelle einmal zusammen:
Tauschen Sie die TAE-Dose gegen eine Ethernet-Doppeldose aus. (ab 10,- €)Tauschen Sie das Kabel zum Router gegen ein gutes LAN-Kabel aus. (ab 5,- €)Nutzen Sie einen guten Router (ab 150,- €)Gönnen Sie dem Router ein audiophiles Netzteil (ab 300,- €) und ein gutes Stromkabel (ab 100,- €).Stellen Sie den Router mindestens 3m von der Anlage entfernt auf. (0,- €)Verbinden Sie die Anlage mit dem Router am besten über ein Glasfaser-System, zumindest aber mit einem audiophilen LAN-Kabel. (LAN: ab 8,- €, LWL ab 549,- €)Setzen Sie einen audiophilen Switch ein (ab 400,- €)Gönnen Sie auch dem Switch ein audiophiles Netzteil (ab 300,- €)Verwenden Sie ausschließlich hochwertige, audiophile LAN-Kabel (ab 5,- €, besser ab 166,- €)
Und wie gut ist eigentlich WLAN?
Manchmal geht es einfach nicht (mehr) anders. Das Haus steht, die Wohnung ist frisch renoviert und man kann unmöglich wieder Wände aufreißen, nur um Kabel zu verlegen. Für diesen Fall hält AVM mittlerweile ganz hervorragende MESH-Repeater bereit. Sie werden per WLAN in unser Heimnetz eingebunden und verfügen ausgangsseitig über eine Ethernet-Buchse. Die Verbindung zu unserem Streamer oder Switch stellen wir dann also wieder mit einem guten LAN-Kabel her.Ein Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass wir mit WLAN eine völlige galvanische Trennung erreichen. Das kann manchmal von größerem Vorteil sein als ein gutes LAN-Kabel.
Um Himmels Willen nur kein PowerLAN!
Die Übertragung von Musiksignalen über unser Stromnetz ist wirklich an Übelkeit nicht zu überbieten. Wenn Sie wirklich gut Musik hören wollen, lassen Sie das bitte bleiben!
Eine zweite Fritz!Box statt Repeater?
Geht es nur um die Erweiterung oder Verbesserung des WLAN-Netzes, ist eine zweite Fritz!Box natürlich oversized. Ihre Komponenten sind:
ModemRouterSwitchTelefonanlageAnrufbeantworterDECT-ServerWLAN-ServerMedien-Server … uvm.
Das brauchen wir ja alles gar nicht, weshalb ein Repeater hier deutlich einfacher in das Netz zu bringen ist und auch noch weniger kostet.
Wer allerdings neben dem WLAN auch die DECT-Reichweite erhöhen möchte, der kann durchaus über eine zweite Box nachdenken, um nicht neben den WLAN-Repeatern auch noch DECT-Repeater im Haus verteilen zu müssen.
Und was ist mit einem ganz eigenen Netz (VLAN) ?
Nun, um ein getrenntes Netz für die HiFi-Anlage aufzubauen, muss man sich schon ein wenig in der Netzwerktechnik auskennen und natürlich die geeigneten Gerätschaften besitzen. Ist dies der Fall, brauchen Sie ganz sicher nicht meine Hilfe und auch nicht diesen Artikel.
Allen anderen empfehle ich das bleiben zu lassen, weil doch einige technische Hürden zu nehmen sind und das Ergebnis möglicherweise nicht das bringt, was Sie erreichen wollten.
Bleibt mir am Schluss nur noch auf eine wichtige Sache hinzuweisen, auf das
Phänomen des letzten Meters
Viele Kunden resignieren recht schnell, weil Sie merken, dass Sie meine Tipps nicht umsetzen können. Umbauarbeiten wären nötig, aber die will man nicht.
Andere Kunden glauben, dass sie etwas Gutes tun, wenn Sie das verlegte CAT 5, 6, 7-Kabel direkt mit dem Streamer/Roon-Core-Server verbinden, statt es in einer Netzwerkdose enden zu lassen.Nun, das mag einem logisch vorkommen – ist aber falsch.Im HiFi-Bereich gibt es etwas, was wir das Phänomen des letzten Meters nennen.
Diese Theorie besagt nichts anderes, als dass es relativ gleichgültig ist, wie gut eine Kabelverbindung ist, wenn einfach nur der letzte Meter gut ist.
Wer sich ein teures Stromkabel kauft, der wird von seinen Bekannten zu hören bekommen:
Vom Energielieferanten zu Deinem Haus liegen etliche Kilometer (klanglich miese) Stromkabel. In Deinem Haus liegen etliche Meter (klanglich miese) NYM-Kabel, aber Du glaubst jetzt, dass Du mit dem letzten Meter Stromkabel den Klang verbessern kannst!?
Genau so ist es!
Telefonkabel
Wir haben z.B. 30 Meter minderwertiges Telefonkabel verlegt. (60 Cent/m)Nutzen wir nun auf dem letzten Meter ein hochwertiges LAN-Kabel wie das Furutech LAN8 NCF, gleicht dieser letzte Meter die schlechten Eigenschaften der ersten 30m aus und beschert uns ein unglaublich transparentes und harmonisches Klangbild.
Probieren Sie es aus!
In der Praxis bedeutet das:
Selbst wenn in Ihrem Haus bereits einfache Telefonstrippen oder LAN-Kabel verlegt wurden, ist noch lange nicht alles verloren! Lassen Sie sie einfach in einer Anschlussdose enden.Verwenden Sie dann auf dem letzten Meter zur Komponente hin ein wirklich gutes Kabel und Sie werden sich wundern, wie viel besser das klingen wird.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Einrichtung und Optimierung Ihres Heimnetzes ein wenig helfen. Man kann das alles für Voodoo oder Humbug halten, oder es einfach mal ausprobieren.Jeder, der einige Tausend Euro in seine HiFi-Anlage gesteckt hat, der hat aus meiner Sicht die Pflicht dazu, mindestens den einen oder anderen Tipp zu befolgen und es wenigstens mal auszuprobieren. Denn ansonsten hätte er sich alles vorher sparen können.
Aber Vorsicht!Klang-Suchtgefahr! [...]
Lesen Sie weiter ...
1. August 2022HiFi-Handbuch / StreamingClock, Word-Clock, Master-Clock, Re-Clocking
In meinem Bericht “Clock, Word-Clock, Master-Clock, Re-Clocking” geht es heute darum, diese Begrifflichkeiten zu erläutern und ihre Unterschiede zu beschreiben.
Tipp:
Diese Inhalte finden Sie in dem Produktbeschreibungs-Artikel: MUTEC MC3+USB und REF10 SE120 – weltweit führende Digitaltechnik – Made in Germany im Zusammenhang mit den Geräten von MUTEC noch einmal.
Nachfolgend ein Foto vom MUTEC MC3+USB, der ein Re-Clocking durchführen kann.
Hinweis:
Dieser Bericht richtet sich nicht (!) an Fachleute oder technisch versierte Personen. Ich versuche hier, ein sehr kompliziertes Thema so einfach wie möglich darzustellen.
Die Clock
Das erste wichtige Stichwort lautet „CLOCK“ – zu übersetzen mit: Taktgeber.
Jedes Gerät und jede Baugruppe, die digitale Musiksignale zu verarbeiten haben, besitzen eine Clock und sind auf diese angewiesen.
„Der Takt macht die Musik“
… so sagt es eine alte, einfache Weisheit.
Doch ganz so einfach wie man sich die Sache vorstellt, ist das mit dem Takt gar nicht. Weder beim Musizieren, noch bei der digitalen Musik-Aufzeichnung.
Die Rolle des Takts in der Musik
Punkt 1: Der richtige (!) Takt (die Zählweise)
In der Musik kennen wir eine Menge unterschiedlicher Takte. Im europäischen Raum sind das vor allem der Drei-Viertel-Takt (Walzer) und der Vier-Viertel-Takt (z.B. Foxtrott).
Punkt 2: Die Geschwindigkeit – Beats per Minute (BPM)
Man kann jeden Takt schneller oder langsamer spielen. (wie beim Wiener Walzer oder Langsamen Walzer)
Punkt 3: Den Takt halten!
Ein Musiker sollte den gewählten Takt halten können, also nicht im gleichen Stück mal schneller und mal langsamer werden.
Punkt 4: Gemeinsam im Takt spielen
Immer dann, wenn mehrere Musiker gemeinsam Musik machen, kommt es nicht nur darauf an, dass sie den selben Takt (also z.B. einen Drei-Viertel-Takt) spielen, sondern auch darauf, dass sie ihn im Gleichtakt spielen. Um dies zu erreichen, richten sich kleinere Gruppen oft nach dem taktsichersten Musiker und größere Orchester benötigen einen Dirigenten.
Was bedeuten diese Erkenntnisse aus der Musikwelt für die digital aufgezeichnete Musik?
Vom analogen zum digitalen Signal
Um dies zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal vor Augen führen, wie ein analoges Musiksignal digitalisiert wird.
Schauen wir uns hierzu eine (ganz einfache) analoge Signalkurve an:
Im Vergleich dazu jetzt die Digitalisierung am Beispiel der CD-Auflösung:
Das Format einer CD liegt bei 16 Bit und 44.1 kHz, was bedeutet:
44.100 Mal pro Sekunde wird die analoge Signalkurve bei der Umwandlung in ein digitales Signal abgetastet.
44.100 Mal pro Sekunde (das ist die Zeitachse) wird also „nachgesehen“, an welcher Stelle (wie hoch/tief) die Kurve steht.
Um die Höhe (Dynamiktiefe) exakt zu bestimmen, arbeitet das CD-Format pro gelesener Information (Sample) mit einer Reihe aus 16 Nullen und Einsen, aus denen sich (rechnerisch!) 65.536 (= 2 hoch 16) verschieden hohe Pegelzustände ableiten lassen.
Beim High-Resolution-Audio-Format (24Bit bei 96 kHz) wird also sogar 96.000 Mal pro Sekunde eine 24-stellige Reihe aus Nullen und Einsen geschrieben und gelesen. Das sind (wieder rechnerisch!) 16.777.216 (= 2 hoch 24) verschieden hohe Pegelzustände pro Sample.
Obwohl diese theoretischen Möglichkeiten aus technischen Gründen nicht ausgenutzt werden, haben wir es hier mit unvorstellbar vielen Informationen zu tun und man sollte annehmen, dass das mit einer extrem hohen Klang-Qualität einhergehen sollte.
Leider ist das aber beim CD-Format noch nicht so ganz der Fall gewesen, weshalb heute noch viele Musikliebhaber (selbst “Digitalos”) den CD-Klang als zu „künstlich“ empfinden.
Ist digital also immer noch schlechter als analog?
Aus den Erfahrungen mit der CD heraus den Schluss zu ziehen, dass das digitale Format grundsätzlich und damit für „immer und ewig“ dem analogen Format unterlegen bleiben würde, war und ist von Grund auf falsch.
Heute stimmt das so einfach nicht mehr.
Zwar haben peinliche Dinge wie die MP3-Einführung in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es mit der digitalen Musik-Qualität schlechter statt besser wurde, aber diese unrühmlichen Zeiten sind vorbei und wirken sich heute auf den anspruchsvollen Musikmarkt mit seinem HRA-Streaming-Angebot zum Glück nicht mehr aus.
Parallele zur Fotografie
In der Fotografie lag die wichtige Schwelle, ab wann der Mensch ein digitales Foto nicht mehr als solches entlarven kann, bei etwa 12 MP (MegaPixel). Als diese Auflösung möglich wurde, war das menschliche Auge nicht mehr in der Lage, bei einem ausgedruckten Fotoformat von etwa 10×15 cm einen Unterschied zwischen einem analog und einem digital produzierten Bild auszumachen.
Im HiFi-Bereich haben sich die Tonmeister auf das „Schwellen-Format“ 24 Bit bei 96 kHz geeinigt. Denn bei diesem Format ist der Mensch nun auch nicht mehr in der Lage, digital von analog zu unterscheiden. Und anders als bei den Behauptungen des Fraunhofer-Instituts zur MP3-Datei, entsprechen diese Aussagen diesmal auch der Realität.
Eine solche digitale Kurve sieht im bildlichen Vergleich dann so aus:
Fazit:
Wir wissen nun, dass ein analoges Signal beim Digitalisieren 96.000 Mal pro Sekunde abgetastet und die Höhe der Signalkurve durch eine 24 Bit “Wortbreite” beschrieben wird. (HRA-Format)
Mit diesem Wissen können wir uns jetzt etwas genauer anschauen, was beim Lesen eines digitalen Signals von Bedeutung ist.
Der Takt im digitalen System
Beginnen wir wieder mit dem Thema Takt an sich
Genau wie bei einer Musikgruppe, bei der ja auch alle wissen sollten, ob sie jetzt einen Walzer oder einen Foxtrott spielen werden, muss eine Komponente wissen, ob sie 44.100 Mal/Sekunde die 16Bit-Samples auslesen muss oder 96.000 Mal die 24Bit-Samples.
(… oder ein anderes Format)
Nun – diese Aufgabe sollte schnell erledigt sein. Eine in der Datei eingebettete Info genügt hier.
Die Takt-Formate bei der digitalen Musikspeicherung
Im Audio-Bereich finden wir heute üblicherweise die beiden Frequenzreihen 44,1 kHz, 88,2 kHz, 176,4 kHz und 48 kHz, 96 kHz, und 192 kHz.
Wobei auffallen sollte, dass sich die beiden Frequenzen 44,1 kHz und 48 kHz parallel zueinander immer schrittweise verdoppeln. Leider passen die beiden Frequenz-Reihen mathematisch überhaupt nicht zusammen, was Digital-Analog-Wandlern Probleme bereitet und was daher bereits eine Ursache für ein nicht so tolles Klangbild sein kann.
Will man eine Audio-Datei aus der einen Frequenzreihe in eine Frequenz aus der anderen Reihe umwandeln, führt das unweigerlich zu Qualitäts-Verlusten, wie wir sie von minderwertigen DA-Wandlern kennen.
Bessere Wandler arbeiten deshalb mit zwei (!) optimierten Clock-Frequenzen und schalten je nach zugeführtem Format zwischen ihnen hin und her. Das ist dann manchmal dieses Klicken, was wir zwischen den Titeln hören können.
Kommen wir zu den Themen „Geschwindigkeit“ und „im Takt bleiben“.
Die Takt-Geschwindigkeit sollte uns theoretisch gar keine Sorgen machen können, ergibt sie sich ja logischerweise aus der verwendeten Frequenz. Schließlich reden wir hier z.B. von 96.000 Mal pro Sekunde – was man in der Musik wohl mit BPM (Beats per Minute) beschreiben würde.
Dass dieser Lese-Takt stabil bleiben muss, versteht sich von selbst, denn schon minimalste Abweichungen führen zum Daten-Chaos und das System liest den falschen Sample oder nur Unsinn!
Die kleinsten Zeitfehler, oft auch mit “Taktzittern” bezeichnet, nennt man “Jitter”. Dass auch sie die Klangqualität nicht gerade verbessern, dürfte einleuchten.
Jitter kann sich aber nicht nur beim Lesevorgang ergeben, sondern auch auf dem kompletten Signalweg. Ein schlechtes Kabel, eine minderwertige Buchse … und die Jitterwerte steigen an. Das kann sogar zu hörbaren Störungen oder zum Totalausfall des Signals führen.
Nun zum Thema „Gleichtakt“
Für einen einzelnen, taktsicheren Musiker ist dieses Problem nicht vorhanden und für eine einzelne, hochwertige digitale Komponente eben auch nicht.
Das ändert sich hier wie dort, wenn mehrere Musiker/Komponenten zusammen Musik machen sollen.
Genau in diesem Moment kommt es nämlich nicht nur darauf an, dass sie beide den gleichen Takt einhalten, sondern sie müssen ihn auch “synchron”, also im Gleichtakt einhalten. Das ist ein großer Unterschied!
Wir wollen: Eins-Zwei-Drei, Eins-Zwei-Drei … und zwar von allen Musikern!
und nicht Eins-Eins-Zwei-Zwei-Drei-Drei-Eins-Eins-Zwei-Zwei-Drei-Drei… 🙂
Damit das funktioniert, ernennt sich das digitale Quellgerät, z.B. der CD-Transport, zum “Master” und degradiert alle nachfolgenden Komponenten-Clocks zu “Slaves”.
Der CD-Transport wird also zum Dirigenten, dem alle Musiker (Clocks) zu folgen haben.
Lassen Sie sich nun aber bitte nicht dadurch verwirren, dass sich der CD-Transport zum “Master” ernennt. Deshalb wird er noch lange nicht (!!) zur “Master-Clock”! Dazu später mehr.
Master – Slave
Im technischen Bereich werden diese beiden Begriffe schon immer gerne genutzt. Man kann mit ihnen zum Ausdruck bringen, dass es das eine Gerät gibt, was etwas „zu sagen hat“ (Master) und andere, die auf das zu hören haben, was vom Master bestimmt wird. Das sind dann die Slaves.
Durch diese Methode können sich die Clocks digitaler Musik-Komponenten auch ohne eine Master-Clock synchronisieren, was eine zwingende Voraussetzung für die klanggetreue Musikwiedergabe darstellt.
Nach so viel Takt sollten wir uns jetzt vielleicht noch einmal einige weitere Punkte etwas genauer betrachten.
Sorry – aber noch ein wenig Theorie muss sein.
Was ist eigentlich eine Clock?
Die Clock ist ein Taktgeber. Für diesen Baustein greift man auf Schwing-Quarze zurück.
Diese Quarze gibt es in natürlicher und in künstlich hergestellter Form. Die Herstellung ist in beiden Fällen kompliziert und bei den angegebenen Schwingungsfrequenzen handelt es sich in der Regel um Circa-Werte, die im Nachhinein auch nicht mehr verändert werden können. Den HiFi-Entwicklern fällt daher die schwierige Aufgabe zu, sowohl Quarze zu selektieren, als auch durch eine entsprechende elektronische Regelung dafür zu sorgen, dass am Ende brauchbare Frequenzen vorhanden sind.
Mehr über Schwing-Quarze finden Sie im Netz, z.B. auch bei Wikipedia.
Bestimmt die Clock also die Qualität einer digitalen Komponente?
Da wir in Digital-Komponenten sowohl bei den Quarzen als auch bei den Regelungen auf unterschiedliche Qualitäten stoßen, kommt es in der Praxis tatsächlich zu unterschiedlichen Klang-Ergebnissen und damit eben auch zu Qualitätsunterschieden.
Manche Hersteller setzen bei den Quarzen extrem aufwändige Selektionsverfahren ein, die sich dann natürlich später im Preis der Komponente widerspiegeln.
Word-Clock
Dies ist kein elektronischer Baustein!
Mit Word-Clock bezeichnet man die Frequenz und die Wortbreite, mit der ein analoges Signal digitalisiert wurde. Also z.B. 44,1 kHz bei 16 Bit (CD-Format).
Ein Solitär (CD-Player, All-in-One-Streamer …) kann diese Informationen aus der digitalen Datei herauslesen und sich unabhängig von anderen Komponenten darauf einstellen.
Kommt es zu einer mehrteiligen Geräte-Kombination, übernimmt (wie wir bereits wissen) das Quellgerät (z.B. der CD-Transport) die Aufgabe eines Masters und sorgt nicht nur dafür, dass alle Clocks in den nachfolgenden Geräten die Information über den Takt (z.B. 44,1 kHz) erhalten, sondern auch dafür, dass sie mit seiner Clock im Gleichtakt schwingen.
Die Master-Clock
Die Master-Clock ist immer eine externe Komponente mit Anschlüssen für mehrere digitale Geräte.
Sie ist sozusagen der Dirigent, der allen Komponenten (Musikern) den korrekten Takt vorgibt.
Und genau wie in einem Orchester sorgt auch hier der Dirigent dafür, dass taktschwache Musiker oder in unserem Fall minderwertige Clocks die hohe Qualität der Master-Clock übernehmen und somit Präzisionsleistungen vollbringen, zu denen sie ohne die Master-Clock niemals in der Lage wären.
Hierdurch erklärt sich auch, dass selbst eine einzelne (!) Komponente, die wir an eine Master-Clock anschließen, sofort mit einem besseren Klangbild reagiert. Auch ein einzelner taktunsicherer Musiker würde ja von einem Dirigenten profitieren.
Re-Clocking am Beispiel des MUTEC MC3+USB.
Während eine Master-Clock den Dirigenten darstellt, der allen Musikern den korrekten Takt vorgibt, kümmert sich der MC3+USB darum, den instabilen und unsauberen Takt eines einzelnen “Musikers” zu berichtigen.
Verbinden wir das USB-Kabel des Quellgeräts (heute meistens des Streamers) mit einem Re-Clocker, trennt dieser im ersten Schritt die Audio-Bit- von den Taktsignalen und verwirft dann die eingegangenen Taktsignale komplett. Inklusive Störungen, Rauschen und Jitter.
Im zweiten Schritt baut er sie dann wieder neu auf.
Zu USB:
Immer noch werden die USB-Schnittstellen vor allem von DAC- Entwicklern als minderwertig betrachtet und daher vernachlässigt. Auch bei Herstellern halten sich eben manche Vorurteile hartnäckig über eine sehr lange Zeit. Und so lange schlechte USB-Schnittstellen verbaut werden, kann sich an diesem Vorurteil auch nichts ändern. Ein Teufelskreis!
Dem entgegen steht die Tatsache, dass immer mehr Quellgeräte auf USB setzen, auch im Hochpreis-Sektor. Wodurch die DAC-Entwickler gezwungen werden nachzubessern.
Re-Clocker wie der MUTEC MC3+USB kann auch da so ein Retter in der Not sein, da er eingangsseitig mit USB und ausgangsseitig mit AES/EBU, Coax, Toslink und BNC arbeitet.
Zusammenfassung:
Seitdem wir durch das Streaming Zugang zu High-Resolution-Audio-Dateien erhalten haben und sich damit die digitale Musik stolz und gleichwertig neben der analogen Musik positioniert, werden auch die wahren Problemstellen einer digitalen Kette immer deutlicher und können so gezielt bekämpft werden.
Während wir beim Plattenspieler kritische Punkte wie die Entkoppelung, die Justage, den elektrischen Abschluss usw. kennen, treffen wir beim digitalen Equipment auf das Thema „Takt“.
Und wer der analogen Klangqualität endlich eine digitale Wiedergabe auf “Augenhöhe” entgegensetzen will, der sollte sich um dieses Thema kümmern. [...]
Lesen Sie weiter ...
17. April 2022HiFi-HandbuchMuss man HiFi-Geräte ausphasen?
In meinem Bericht „Muss man HiFi-Geräte ausphasen?“ gehe ich auf Sinn und Unsinn dieser Maßnahme und spezieller Messgeräte für das Ausphasen von HiFi-Komponenten ein.
Hinweis:
Dieser Bericht bezieht sich allein auf Deutschland. In anderen Ländern gibt es unterschiedliche Versorgungs- und Steckerarten und daher auch abweichende Vorgehensweisen.
Die richtige Phase – worum geht es eigentlich?
Elektrogeräte beziehen ihren Wechsel-Strom über ein Stromkabel und dieses steckt üblicherweise mittels eines genormten Schutzkontakt-Steckers in der Schutzkontakt-Steckdose.
Ganz einfach ausgedrückt gibt es in der Steckdose „Plus“, „Minus“ und „Masse“.
Wer sich etwas besser auskennt, wird jetzt rufen: „Plus und Minus gibt es nicht beim Wechselstrom, das nennt sich Phase und Null!“.
Ich habe hier aber nicht vor, Ihnen in diesem Bericht die Funktionsweise eines Wechselstromnetzes oder die Nomenklatur eines Elektrikers zu erläutern – dafür gibt es Literatur von viel kompetenteren Leuten als mich.
Von Bedeutung für diesen Bericht ist einzig und allein die Feststellung, dass wir einen Schukostecker in zwei (!!) Variationen in eine Steckdose stecken können. Wir können ihn nämlich herausziehen, um 180° drehen und seine beiden Stifte passen wieder hinein.
Und ob wir nun „Plus und Minus“ sagen oder „Phase und Null“ – mal liegt Plus/Phase an dem einen Stift an und mal an dem anderen.
Dadurch fließt der Strom aber nicht etwa das eine mal so und und das andere mal anders herum, sondern der Strom fließt immer hin und her – denn es ist ja Wechselstrom.
Elektrisch gesehen ist es daher auch vollkommen gleichgültig, in welcher Stellung der Schuko-Stecker in der Dose steckt, denn funktionieren wird das Gerät immer. Wäre ja auch ein ziemlich blödes System, wenn es nicht so wäre.
Geräte, bei denen es aber doch auf eine korrekte Phase ankommt (wie zum Beispiel bei Ihrer Heizungsanlage) dürfen auf keinen Fall (!) über einen Schukostecker betrieben werden!!
Solche Geräte haben ein Anschlussfeld und dort ist zwingend Phase auf Phase und Null auf Null aufzulegen – sonst funktioniert es nicht oder es geht sogar kaputt.
Also – wenn dann ja doch beides funktioniert – was ist dran an der Aussage, HiFi-Geräte müssten ausgephast werden?
Gehäuse-Potentiale – ein Erklärungsversuch.
Immer wieder ließt man darüber, dass man das Gehäusepotential messen und berücksichtigen soll.
Sicher ist Ihre Hand schon mal über eine HiFi-Komponente geglitten und Sie hatten das Gefühl, dass dort eine gewisse elektrische Spannung zu spüren war.
Und genau darum geht es bei dieser Theorie.
Diese Spannung nennt man “Gehäuse-Potential” – also eine Spannung auf dem Gehäuse, die aber bei einem intakten Gerät vollkommen harmlos sein sollte.
Wenn zwei HiFi-Geräte mit unterschiedlich hohen Gehäuse-Potentialen z.B. über ein Cinch-Kabel miteinander verbunden werden, entsteht so etwas, was wir bei Flüssigkeiten von den „kommunizierenden Röhren“ kennen. Egal, wie viel wir in die eine Röhre hineinschütten, immer werden wir in beiden Röhren die selbe Menge Flüssigkeit haben.
Und das funktioniert vom Prinzip her genau so bei HiFi-Komponenten.
Wenn also nun von dem Gerät mit der höheren Gehäusespannung etwas davon über das Cinchkabel in das Gerät mit der niedrigeren Gehäusespannung fließt, haben wir einen Stromfluß durch das Cinch-Kabel – zusätzlich zu unserem Musiksignal – denn auch das ist ja eine elektrische Spannung.
Da die Höhe des Gehäusepotentials auch noch entsprechend der gespielten Musik schwankt, schwankt auch die Menge des Potentialausgleichs.
Und wie soll der Verstärker herausfinden können, was nun vom CD-Player als Musiksignal kommt und was als Potentialausgleich? Antwort: Kann er nicht! Oder zumindest nicht gut.
Aus diesem Grund gibt es immer wieder Versuche, diesen Potentialausgleich über die Stromkabel und eine entsprechende Verteilerleiste oder über zusätzliche Kabelverbindungen zwischen den Geräten und der Erdung unserer Wandsteckdose hinzubekommen.
Manchmal bringt das auch einen Vorteil, aber manchmal holen wir uns auch ein mächtiges Gerätebrummen in unsere Anlage und müssen dann wieder dafür sorgen, dass wir die störenden Verbindungen trennen.
Die sicherste Methode ist da immer noch die, die wir uns von den Musikern abgeschaut haben – nämlich die symmetrische Kabelverbindung.
Hierbei fließen die Musiksignale durch zwei identisch aufgebaute „Innenleiter“ und über einen dritten Leiter findet die Koppelung der beiden Gerätemassen statt.
Diese Lösung setzt allerdings das Vorhandensein von XLR-Buchsen voraus, die leider noch nicht zum Standard geworden sind.
Die Cinch-Verbindung ist deshalb aber noch lange nicht die Schuldige!
Selbst wenn es uns gelingt, die Gehäuse-Potentiale auf ein Minimum zu senken und wenn wir dann auch noch dafür sorgen, dass zusätzliche Masse-Kabel für einen Ausgleich sorgen, so können sich doch immer noch Klangunterschiede durch das Ausphasen ergeben. So schön es auch wäre, aber da scheint es doch auch noch andere Gründe zu geben.
Welche Lösungen zum korrekten Ausphasen gibt es?
Messgeräte
Angefangen hat alles in den 80-er Jahren mit dem Namiki Direction-Finder. In der Praxis kaum zu gebrauchen – aber zumindest ein Versuch. Heute kann sich der engagierte HiFi-Freak Hilfs-Geräte zwischen 60,- € und fast 2.000,- € zulegen, die ihm die „ganz einfache“ Lösung dieses Problems versprechen.
Doch muss ich mich da leider als Spielverderber betätigen. Legen Sie sich nämlich zwei verschiedene Messgeräte zu, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie zu gegensätzlichen Ergebnissen kommen. Selbst wenn Sie sich zwei identische Geräte gleichzeitig kaufen und sie nacheinander nutzen, passiert es immer wieder, dass sie unterschiedliche Ergebnisse anzeigen.
Sonstige Hilfsmittel
Fast jeder hat so ein „Leitungssuchgerät“ zuhause, was stromführende Leitungen finden kann, damit wir nicht direkt in sie hineinbohren.
Halten wir nun ein Plastik-Lineal an das Gehäuse des zu messenden Gerätes, können wir mit dem Leitungssucher am Lineal in Richtung HiFi-Komponente gleiten und uns merken, wann der Leitungssucher einen Ton von sich gibt.
Dann schalten wir die Komponente aus, drehen ihren Schukostecker und schalten sie wieder ein.
Nun wiederholen wir die Messung.
Die Steckerstellung, bei der wir uns der Komponente weiter nähern können, bei der das Messgerät also später piept, die wäre die korrekte Stellung, die wir nun kennzeichnen können.
Kann der Hersteller nicht gleich die korrekte Phase kennzeichnen?
Fragt man Hersteller nach der korrekten Phase, hört man nicht selten: „Ist egal!“.
Manchmal gibt es für diese Aussage einen echten technischen Hintergrund – manchmal ist es fast so etwas wie Resignation und ein andermal stimmt es einfach so.
Am Ende funktioniert nur, sich das anzuhören.
Doch sagen Sie das mal Ihrem Kunden!
Der Deutsche ist pedantisch und will es richtig machen.
Sich auf sein Gehör verlassen zu müssen – das lässt er nicht gelten.
„Man muss es doch richtig machen können!“.
Lassen Sie mich hierzu ein Beispiel aus der Praxis bringen:
Ich hatte in den 80-er Jahren einen Pioneer PD95 CD-Player in Zahlung genommen.
Beim ersten Hören war der Klang eine Katastrophe!
Der Mund des Sängers war so groß wie das Maul eines Walfisches und reichte vom linken bis zum rechten Lautsprecher.
Es fehlte alles, was man mit dreidimensionaler Wiedergabe hätte bezeichnen können.
Das Umdrehen des Schukosteckers (Ausphasen) führte zu einer erstaunlichen Wendung.
Der Mund des Sängers hatte nicht nur wieder eine natürliche Größe, sondern war auch dreidimensional im Raum klar zu positionieren.
Da der Pioneer sich also wunderbar dazu eignete, Veränderungen der Phase klanglich deutlich zu machen, habe ich ihn genutzt, um mit ihm zu experimentieren. Geräte zum Ausphasen gab es damals nur von einigen „Bastelbuden“ oder eben von Namiki.
Das Leitungssuchgerät allerdings kam dabei noch am sichersten zu den immer gleichen Ergebnissen. Unabhängig davon, ob der CD-Player schon mit dem Verstärker verbunden war oder nicht. Das sah bei den “gebastelten” Teilen leider anders aus.
Wobei man jetzt darüber streiten kann, ob sie nicht genau deswegen die korrekteren Werte angezeigt haben. Denn auch heute noch gibt es unterschiedliche Einstellungen zu der Frage, ob die zu messende Komponente während der Messung bereits mit anderen Komponenten verbunden sein darf oder nicht.
Wie unsinnig diese ganze Messerei gewesen ist, ergab sich aus der Tatsache, dass die korrekte Phase je nach verbundenem Verstärker durchaus mal wechselte.
Hatte ich den PD95 mit einem Mark Levinson-Verstärker verbunden, musste er anders ausgephast werden als in der Kombination mit einem Verstärker von z.B. Bryston.
Wurden dann weitere Komponenten an den Verstärker angeschlossen (Phonoteil, Tuner …), konnten die Klangunterschiede größer oder geringer werden.
So groß der Klangunterschied beim PD95 auch sein konnte und meistens auch war – in bestimmten Kombinationen war davon nicht mehr viel zu hören.
… und deshalb vermutlich auch nicht immer exakt zu messen.
Im Ergebnis …
blieb nur die Erkenntnis, dass wir uns zwar Hilfsmittel oder Messgeräte zulegen können, diesen aber auf keinen Fall blind vertrauen dürfen. Und kommt unser Gehör zu einem anderen Ergebnis als unser Messgerät – dann sollten wir doch lieber auf unser Gehör vertrauen!
Fehlendes Selbstvertrauen oder Bequemlichkeit?
Immer wieder erlebe ich, dass Kunden die Aussage nicht gefällt, sie sollten sich das einfach anhören.
Besteht eine Anlage aus fünf Komponenten, so ergeben sich daraus (wenn ich richtig rechne) 2x2x2x2x2 Variationen, was wohl auf 32 hinaus läuft.
Viele Kunden bezweifeln aber, dass sie den Unterschied zwischen 2 Variationen, also wie beim berühmten A/B-Vergleich erhören können. Bei 32 Kombinationen – streicht wohl wirklich jeder die Segel.
Lösung in Sicht?
Zum Glück sind bei vielen Komponenten die erzielbaren Klangunterschiede durch das Ausphasen kaum auszumachen. Bei diesen Geräten kommt es also tatsächlich nicht darauf an, ob der Stecker „richtig“ oder „falsch“ in der Steckdose steckt.
Sich darauf verlassen, sollte man aber eher nicht!
Meine Lösung
Schritt 1 – der Kaltgerätestecker gibt es vor!
Es gibt so etwas wie eine Norm bei der Polung des Kaltgerätesteckers:
Blicke ich auf eine Kaltgerätebuchse im Gerät und stelle mir den mittleren Stift als „Mund“ und die beiden anderen Stifte als „Augen“ eines Smileys vor, dann ist dessen rechtes Auge der Stift auf den die Phase gehört.
Blicke ich also auf die Löcher im Kaltgerätestecker, dann muss auf dem linken Auge Spannung zu messen sein.
Am einfachsten misst man das mit einem berührungslosen Spannungsmesser. Erstens sind die Schlitze im Kaltgerätestecker oft zu klein, um mit einem normalen Spannungsprüfer hinein zu kommen und zweitens ist das deutlich ungefährlicher.
Wenn ich die richtige Phase gefunden habe, kann ich mit einem Lackstift den Schukostecker und die Wandsteckdose kennzeichnen und mir später die Arbeit erleichtern.
Damit habe ich theoretisch meine HiFi-Geräte „normgerecht“ ausgephast und eine gute Ausgangslage für meine Hörtests geschaffen.
Schritt 2 – anhören.
Um diesen Schritt kommen wir einfach nicht herum. Aber wir hören uns jetzt nicht etwa 32 (oder mehr) Varianten an, sondern wir gehen folgendermaßen vor.
Wir beginnen bei den Quellgeräten.
Also zum Beispiel beim CD-Player.
Und jetzt hören wir uns beide Steckerpositionen in Ruhe an.
Dabei achten wir vor allem auf die Fokussierbarkeit, auf die Größenabbildung, auf die dreidimensionale Darstellung.
Rechnen Sie nicht damit, dass sich eine Stimme oder der Klang eines Instruments verändert!
Hören Sie keinen Unterschied, stecken Sie den Stecker wieder so in die Steckdose „wie er laut Norm“ hinein gehört.
So gehen wir bei allen Quellgeräten vor, dann bei Zwischengeräten (z.B. Phonoteil oder DAC) und am Schluss beim Vorverstärker und beim Endverstärker, bzw. bei den Aktivboxen.
Monoblöcke oder Aktivboxen sollten natürlich immer identisch angeschlossen sein, weshalb wir sie gemeinsam umphasen müssen.
Was bringt mir das?
In vielen Fällen werden Sie bei diesem Hörtest kaum einen Unterschied hören können. Dann sollten Sie sich auch von niemandem erzählen lassen, dass Sie unbedingt ein Messgerät zum besseren Ausphasen benötigen!
Wenn es keinen Unterschied gibt – was sollen wir dann messen?
Manchmal werden Sie einen Unterschied hören, sich aber nicht sicher sein, was „besser“ ist. Hier kommen Sie nicht umhin, in den nächsten Tagen einfach mal über eine längere Zeit hinweg die eine und dann die andere Stellung zu testen.
Niemals A/B-Vergleiche machen!!!
A/B-Vergleiche sind extrem nutzlos.
Sie zeigen uns nur die Unterschiede zwischen A und B und sagen nichts über die tatsächliche Qualität aus.
So kann Ihnen ein furchtbar aggressiver Klang als angenehm harmonisch erscheinen, wenn das Ergebnis B noch viel aggressiver klingt.
Stattdessen sollten Sie wirklich über mehrere Tage die eine Position und dann über mehrere Tage die andere Position testen.
Ist das Ergebnis dagegen ziemlich eindeutig – dann sollten Sie auch das Selbstbewusstsein haben, diese Stellung zu wählen.
Es spricht ja nichts dagegen, es nach einigen Tagen ruhig mal wieder anders zu probieren.
Merke:
Ein gutes Klangergebnis ergibt sich niemals (!!) aus der Tatsache, dass man irgendwas gemessen hat oder irgendwelchen Faustformeln gefolgt ist.
Ein gutes Klangergebnis will erarbeitet werden.
Hören Sie – hören Sie – hören Sie!
Wenn Sie wirklich keinen Unterschied hören können – hilft Ihnen auch das teuerste Messgerät nicht. Wenn Sie ihn hören, dann vertrauen Sie ihrem Gehör und keinem Messgerät! [...]
Lesen Sie weiter ...
13. Dezember 2021HiFi-HandbuchWas tun, wenn es im Lautsprecher brummt?
Immer mal wieder erreicht uns die Anfrage: „Was tun, wenn es im Lautsprecher brummt?“ und deshalb will ich in diesem Bericht mal etwas näher auf dieses Problem eingehen.
Was sich Gewerbetreibende für ihr Geschäft sehnlichst wünschen, nervt HiFi-Freaks ganz gewaltig: Es brummt!
Und wie bekommen wir das wieder weg?
Vorab:
Jedes an unser Stromnetz angeschlossene Audiogerät brummt und rauscht.
Allerdings sollte davon im Normalfall wenig bis fast gar nichts im Lautsprecher zu hören sein.
Rauscht aber doch!?
Rauscht es doch, dann liegt es entweder daran, dass wir den Verstärker ohne ein anliegendes Musiksignal zu laut „aufgedreht“ haben, dass eines der betriebenen Geräte mehr rauscht als üblich oder dass der Verstärker und die Lautsprecher nicht miteinander harmonieren. Im letzten Fall hat der Lautsprecher eine zu hohe Empfindlichkeit. Daran muss man sich entweder gewöhnen oder die Boxen wechseln.
Damit ist das Thema „Rauschen“ aber auch schon so gut wie abgehandelt.
Brummt aber doch!?
Brummt es dagegen hörbar im Lautsprecher, dann kann das Tausend und einen Grund haben.
… und die Suche nach der Ursache recht schwierig werden.
Um erahnen zu können, wo man wohl mit der Suche starten sollte, will ich Ihnen hier ein paar Tipps geben.
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen:
Einstreuungen durch das Stromnetz
Einstreuungen „durch die Luft“
Defekte Kabel oder Buchsen
Das Zusammentreffen von Potentialen
Erdungsbrummen
Einstreuungen durch das Stromnetz
Unser Stromnetz ist „schmutzig“.
Wer noch ein 30 bis 40 Jahre altes Babyphon zur Verfügung hat, der kann sich diesen „Schmutz“ ganz einfach mal anhören.
Schaltknackser irgendwo im Haus knallen regelrecht durch das Babyphon und ein permanentes Prasseln, Gurgeln, Zischen und noch viel mehr untermalen das Eigenrauschen dieser Geräte.
Diese Störgeräusche beeinflussen unsere Audio-Geräte, weshalb der Zubehörmarkt heute reichlich „Hilfsmittel“ bereit hält. Das Brummen im Lautsprecher verhindern sie jedoch meistens nicht.
Es sind die Trafos!
Trafos verursachen vielfach Brummeinstreuungen ins Stromnetz. Und wenn man etwas dimmen kann, wie z.B. bei einer Stehlampe, dann steigert sich das noch. Selbst diese stylischen Plattenspielerlampen (damit man die Nadel an die richtige Stelle setzt) sind nicht selten der Verursacher von Brummgeräuschen.
Schwierig wird das Finden des Verursachers dadurch, dass diese Trafos oft auch im scheinbar ausgeschalteten Zustand (standby) noch Störungen verursachen und nur das Ziehen des Steckers Klarheit bringt.
Lösung:
Gehen Sie auf die Suche nach Trafos in Stehlampen, Vitrinenbeleuchtungen, Deckenstrahlern, Dimmern, Aquarien …
Denken Sie dabei auch an benachbarte Räume und vor allem auch an die Zimmer, die hinter der Wand liegen, an der die Stereoanlage aufgestellt ist.
Einstreuungen „durch die Luft“
Elektrische Geräte erzeugen manchmal ein ziemlich starkes Störfeld.
Geraten empfindliche Audiogeräte in solch ein Störfeld, nehmen sie die Störungen auf und verstärken sie – schon brummt es im Lautsprecher.
Stellen wir zum Beispiel unseren Phonoverstärker auf eine Komponente – vielleicht sogar genau dort hin, wo im Gehäuse der Trafo sitzt – oder stellen wir die Plattenspielerlampe direkt auf das Phonoteil – dann ist ein Brummen durch Einstreuungen mit Sicherheit zu erwarten.
Lösung:
Solche Ursachen finden wir recht schnell. Wir müssen es nur mal „brummen lassen“, dann unsere Geräte und/oder Kabel etwas bewegen und darauf lauschen, ob sich das Brummen verändert. Ist dies der Fall, haben wir schon den Verursacher gefunden, Wir müssen die beiden Geräte jetzt nur noch weit genug voneinander trennen.
Schwieriger zu ermitteln ist es, wenn das Brummen durch parallele Leitungen (Induktion) verursacht wird.
Manchmal meint man es einfach zu gut. Da wird ein Kabelkanal gelegt und dann kommen alle möglichen Kabel gemeinsam in diesen Schacht hinein. Vielleicht ist sogar das eine oder andere Stromkabel dabei.
So „schön ordentlich“ das dann auch aussehen mag – es verursacht aber vielleicht auch das Brummen.
Defekte Kabel oder Buchsen
Lange Zeit war alles in Ordnung, doch auf einmal wird man so ein Brummen nicht mehr los?
Nicht selten hat sich einfach ein Stecker gelöst und sitzt nicht mehr richtig in der Buchse. Diese Cinch-Stecker mit ihren „Bohrfutterhüllen“ sind toll, aber den einen zieht man linksrum fest den nächsten rechtsrum. Und wenn man dann vor der Anlage steht, weiß man gar nicht mehr, wie rum man drehen muss. Schon sitzt alles derart fest, dass man nur noch mit Gewalt voran kommt.
Ruckzuck ist es passiert. Die Cinchbuchse dreht sich mit. Im Gerät wickeln sich die dünnen Käbelchen umeinander, bekommen Kontakt oder reißen einfach ab.
Reißt der „heiße“ Leiter – ist der Kanal tot. Beim zweiten Leiter spielt die Musik einfach weiter, denn den fehlenden Kontakt holt sich das Gerät dann eben vom anderen Stereo-Kanal.
Allerdings stellt sich dann auch gerne so ein Brummen ein.
Manchmal verschwindet es, sobald wir den Eingang am Verstärker umschalten, manchmal aber auch leider nicht.
Das Zusammentreffen von Potentialen
Den Begriff Potentiale zu erklären, würde an dieser Stelle zu weit reichen. Die Erläuterung dazu finden Sie im Bericht „Erdung und Potentiale“ in meinem HiFi-Handbuch (wenn es denn mal fertig ist).
Zu unterschiedlichen Potentialen kann es kommen, wenn wir verschieden geerdete Netze miteinander koppeln.
Unser Stromnetz ist das eine geerdete Netz. Der Kabelanschluss für TV und Radio kann das zweite Netz sein. Über das Antennenkabel führen wir beide Netze zusammen.
So eine Brummquelle entlarven wir also ganz einfach durch das Abziehen der Antennenkabel an allen Geräten, die mit unserer Stereoanlage verbunden sind.
Lösung
Der Elektrohandel hält für dieses Problem Mantelstromfilter bereit. Am besten schildern Sie dem Verkäufer Ihr Problem exakt, denn es gibt recht unterschiedliche Mantelstromfilter.
Erdungsbrummen
Eine sehr häufige Brummquelle ist das Erdungsbrummen.
In Deutschland haben wir so genannte Schutzkontakt-Steckdosen mit insgesamt drei Kontakten (Polen).
Für gewöhnlich nennen wir sie Plus – Minus – und Erde, was aber falsch ist. Die korrekte Bezeichnung lautet Aussenleiter (oder Phase), Neutralleiter und Schutzkontaktleiter.
Die Erdung ist für den Betrieb eines Elektrogerätes nicht zwingend erforderlich, es funktioniert auch ohne – sie kann uns aber das Leben retten, wenn mal etwas nicht in Ordnung ist.
Trotzdem gibt es auch Geräte, die lediglich einen zweipoligen Flachstecker (Eurostecker) besitzen und damit keinen Kontakt zum Masseleiter (Erdung) erhalten.
Ist dadurch die Betriebssicherheit gefährdet?
Den Punkt Betriebssicherheit will ich hier nicht aufgreifen, da die Verwendung der richtigen Kabel und Stecker nicht nur ein weites, sondern in Fachkreisen auch gerne kontrovers diskutiertes Thema ist. Von richtig, falsch oder gar gefährlich zu sprechen, ist hier also nicht relevant.
Ist der Klang gefährdet?
Ganz sicher ja! So lange wir Audiogeräte mit zweipoligen Kabeln (Cinch) verbinden, fließen nicht nur die Musiksignale durch diese Kabel sondern es findet auch der Potentialausgleich von einem Gerät zum anderen über die gleichen Leitungen statt. Und das kann nicht gut sein. Um für eine solide und ungestörte Musiksignal-Übertragung zu sorgen, müssten wir auf dreipolige Kabel und Steckverbindungen zurückgreifen. Aber dann auch vollständig – nicht nur hier und da mal eine. Im PA- und hochpreisigen Audiobereich finden wir deshalb überwiegend die dreipoligen XLR-Verbindungen.
Doch auch das ist hier nicht unser Thema.
Zu viel Erde – zu wenig Erde
Uns geht es darum, dass wir durch die Beschaffenheit der Geräte, der Stromkabel, Stecker und Audioverbindungen immer mal wieder mit einem kräftigen Brummen im Lautsprecher konfrontiert werden.
Und die korrekte Frage lautet dann: Haben wir jetzt eigentlich zu wenig Erdung oder zu viel?
Das Komplizierte daran:
Beide Zustände können das Brummen hervorrufen.
Unser Phonokabel am Plattenspieler hat in der Regel einen zusätzlichen Masseleiter, den wir sowohl am Plattenspieler als auch am Verstärker an den dafür vorgesehenen Erdungsklemmen anzuschließen haben.
In den meisten Fällen verschwindet dadurch das Brummen auf der Stelle.
Es kommt aber auch hin und wieder dazu, dass genau durch diese Masseleitung „zu viele“ Erdungspunkte in die Anlage gelangen. Hierdurch kommt es dann zu einer Brumm- oder auch Erdungsschleife.
Aber nicht nur die Masseleitung kann diese Brummschleife verursachen. Schon der Hersteller kann sie im Tonabnehmer bewusst legen.
Gerne wird nämlich der Minuspol des linken Kanals an Masse angelegt.
Er macht das in der Absicht, Brummprobleme zu verhindern, erreicht aber in manchen Anlagen genau das Gegenteil.
Zu der Erdung über den linken Kanal, die sich ja jetzt logischerweise mit dem Musiksignal bis hin in den Verstärker zieht, kommt es manchmal zu einer zweiten Erdung über das Tonabnehmergehäuse, das elektrischen Kontakt zur Headshell hat. Hat die Headshell wiederum leitenden Kontakt zum Tonarm und liegt dieser selbst an Masse an – ist der Tonabnehmer damit doppelt geerdet.
Das kann völlig ok sein, muss es aber nicht. Ergebnis: Es brummt.
Abhilfe schafft dann oft das Isolieren des Tonabnehmers von der Headshell durch Isolierband oder ähnliches.
Doch aufgepasst!
Manchmal hat der Tonabnehmerhersteller alles richtig gemacht und wir setzen selbst die Ursache.
Benutzen wir nämlich zu lange Schrauben, kann es sein, dass wir im Tonabnehmergehäuse mit dieser Schraube an einen signalführenden Kontakt stoßen und dadurch eine Brummschleife herstellen. Ist dies der Fall, brauchen wir kürzere Schrauben oder wir verwenden gleich welche aus Kunststoff.
Kurz und gut – der Plattenspieler ist schon nicht gerade selten der Verursacher von Brummgeräuschen und wenn Sie noch einen in Betrieb haben, dann würde ich auch hier mit meiner Such beginnen.
Ansonsten hat sich die folgende Vorgehensweise als nützlich erwiesen.
Schritt 1
Wir ziehen alle (!) Eingangskabel vom Verstärker ab und lassen nur noch das Strom- und die Lautsprecherkabel angeschlossen.
Brummt es dann, gibt es die folgenden möglichen Ursachen:
Der Verstärker ist defekt.
Es gibt Einstreuungen in den Verstärker
Es gibt Einstreuungen in das Stromnetz, die der Verstärker wiedergibt.
Es gibt Einstreuungen in die Lautsprecherkabel
Brummt es nicht, gehen wir über zu Schritt 2
Nun schließen wir das erste Gerät wieder am Verstärker an. Sollten wir noch einen Plattenspieler betreiben, dann beginnen wir natürlich mit ihm. Ansonsten nehmen wir irgend eine Komponente.
Brummt es, haben wir den Verursacher auf Anhieb gefunden.
Nun gibt es folgende Möglichkeiten:
Das angeschlossene Gerät ist defekt oder es ist von Einstreuungen betroffen
Das Kabel des angeschlossenen Gerätes ist defekt oder ist von Einstreuungen betroffen
Die Eingangsbuchse des Verstärkers ist defekt (anderen Eingang nehmen)
Der Eingang am Verstärker ist defekt (anderen Eingang nehmen)
Dieses Quellgerät erzeugt im Zusammenspiel mit dem Verstärker eine Brummschleife
Brummt es nicht, ziehen wir die Cinchkabel von diesem Gerät wieder ab und schließen das zweite Gerät am Verstärker an. So machen wir weiter, bis wir alle unsere Quellgeräte jeweils einzeln am Verstärker getestet haben. Brummt es irgendwann, haben wir den Verursacher gefunden, brummt es nie, erzeugt wohl eher die Kombination unserer Geräte das Brummen. Unter General-Verdacht stehen da jetzt zunächst alle Geräte mit Antennenanschluss. (Tuner, TV, Video …)
Um den Verursacher unter diesen Bedingungen zu finden, kehren wir die Versuchsreihe um und schließen nun zunächst alle Geräte wieder am Verstärker an. Brummt es jetzt (seltsamerweise) nicht, können wir davon ausgehen, dass einfach irgendein Kabel nicht richtig in der Buchse gesteckt hat oder es in einem Kabel einen Wackelkontakt gibt.
Brummt es jetzt wieder, dann vertragen sich hier zwei Geräte nicht miteinander. Erdungstechnisch gesehen. 🙂
Deshalb ziehen wir jetzt der Reihe nach jedes Gerät wieder einzeln vom Verstärker ab. Brummt es weiter, schließen wir es wieder an und fahren mit dem nächsten Gerät fort, bis das Brummen verschwindet. Irgendwann werden wir also einen Verursacher gefunden haben.
Dieses Gerät sorgt dafür, dass es eine Erdungsschleife gibt.
Möglicherweise ist es defekt – vielleicht stimmt aber auch was mit dem Kabel nicht. Bleibt das Brummen auch mit einem anderen Kabel – liegt es wohl mehr am Gerät, was wir dann in einer Werkstatt prüfen lassen sollten.
Bitte nicht die Massekontakte am Schukostecker abkleben!!
Es ist eine beliebte Notlösung, bei Brummproblemen einfach die Massekontakte des Schukosteckers mit Isolierband abzukleben. Tatsächlich wird auch immer mal wieder das Brummen genau dadurch beseitigt. Bedenken Sie aber bitte, dass die Sicherheit des Gerätes – und die Ihre !!) – nicht mehr gewährleistet ist.
Irgendwas muss ja das Brummen verursachen.
Möglicherweise besteht irgendwo ein Kontakt zwischen der Masse (Gerätegehäuse) und einem Kanal – im schlimmsten Fall sogar zu einem spannungsführenden Bauteil.
Eine moderne Elektroinstallation kann darauf reagieren und den Fehlerstrom-Schutzschalter im Hauptverteiler auslösen (FI). Sind aber die Schutzkontaktstifte abgeklebt, ist dieser Schutz nicht mehr vorhanden.
Also unterlassen Sie das lieber, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.
Fazit:
Ich hoffe, ich konnte die Frage: „Was tun, wenn es im Lautsprecher brummt?“ hinreichend beantworten und Ihnen Anhaltspunkte dafür geben, wo Sie mit der Suche nach einem Verursacher beginnen können.
Hinweis:
Normalerweise reicht es zum Verbinden oder Trennen der Cinchkabel aus, die Lautstärke am Verstärker ganz herunter zu regeln. Wir müssen uns hier aber vor Augen führen, dass wir möglicherweise einen technischen Defekt suchen. Deshalb geben wir uns nicht damit zufrieden, sondern schalten zumindest auch noch den Verstärker auf einen anderen Eingang. Es kann aber auch keine schlechte Idee sein, den Verstärker beim Umstecken ganz auszuschalten. [...]
Lesen Sie weiter ...
13. Dezember 2021HiFi-Handbuch / Roon-Spezial / StreamingWohin gehört die Fritz!box?
Wohin gehört die Fritz!box?
Wenn es um das Streamen von High-Resolution-Audio-Dateien (HRA) geht, verstreicht kaum ein Tag, an dem ich nicht die Frage gestellt bekomme:
„Wohin gehört die Fritz!Box?“.
(… dieser Bericht gilt natürlich auch entsprechend für Router anderer Hersteller)
Die Ursache dafür liegt in der Historie begraben, denn die Fritz!Box haben wir schon benutzt, als an das Streamen von hochaufgelösten Musikdateien noch nicht zu denken war.
Am Anfang …
war da die TAE-Dose der Deutschen Post. Unantastbar!
Und da unser Telefon über ein Kabel mit dieser Dose verbunden war, befand sie sich zentral im Flur. Dort, wo sie eigentlich niemand so richtig gebrauchen konnte, wo wir aber von allen Zimmern aus das Klingeln des Telefons hören konnten.
Selbst die Einführung der Schnurlostelefone konnte noch immer nichts daran ändern, dass die TAE-Dose im Flur blieb.
Dann kamen der Computer und das Internet.
Bis heute ist es in vielen Haushalten ein ungelöstes Problem, alle genutzten PC (Söhne, Töchter, Büro …) gescheit ans Internet anzubinden.
Netzwerke waren und sind nicht vorhanden oder stammen „aus dem letzten Jahrhundert“. Man muss feststellen, dass das Vernetzungskonzept in unseren Wohnungen und Häusern völlig veraltet und überhaupt nicht zeitgemäß ist.
Ein reines PC-Netzwerk – der nächste große Fehler.
Vielen Familien blieb gar nichts anderes übrig, als das Zuhause mit einem mehr oder weniger professionellen Netzwerk aufzurüsten. Einige verbanden gleich eine komplette Smart-Home-Installation damit. Kabel oder Sensoren an jedes Fenster, an jede Tür, an jeden Heizkörper, an alle Rollläden …
Und die Zentrale sitzt wie eh und je im Flur – oder im Keller.
Auf einmal brauchte man zum Fernsehen einen Internetanschluss.
Selbst extrem teure Smart-Home-Netze zeigen manchmal eine schmerzliche Lücke:
Der Fernseher ist nicht mit angebunden.
Das laufende Programm kann man vielleicht noch über WLAN anschauen, aber Amazon Prime oder Netflix … in höchster Auflösung? Kaum eine Chance!
Also muss noch einmal ein Kabel zum Fernseher gezogen werden.
Und jetzt kommt auch noch HRA-Streaming.
Und so sehen die meisten Situationen in diesem Moment dann aus:
TAE-Dose?
Immer noch im Flur oder im Keller.
Internetanschluss der HiFi-Anlage?
Meistens gar nicht vorhanden – wozu auch?
Ansonsten: WLAN – mit oder ohne Repeater.
Netzwerke über das Stromnetz (Devolo …).
… und im wirklich allerbesten Fall: Ein ultralanges Standard-Netzwerkkabel von der Zentrale im Keller zur Fritz!Box im Flur. Weit weg von der HiFi-Anlage, damit die WLAN-Strahlen bloß nicht den Klang beeinflussen. Und der Streamer ist dann eben mit WLAN angebunden.
Ergebnis:
Streaming klingt nicht! Tidal und Qobuz taugen nichts. Kann man alles abhaken!
Wer diese Realität tagtäglich erlebt, den darf es nicht wundern, dass es immer noch so viele Streaming-Gegner gibt.
Doch jetzt machen wir mal alles richtig!
Zunächst einmal müssen wir erkennen und auch anerkennen, dass wir HRA-Streaming machen wollen. Und dazu dürfen wir nicht mehr unsere gewachsenen Netzwerke nutzen.
Das ist so als würden wir unsere E-Mails ausdrucken und mit der Post verschicken.
Umdenken ist angesagt!
Wir müssen erkennen, dass der Weg hin zum echten High-Res-Audio-Klang über unser Netzwerk führt. Und das müssen wir jetzt an diesen neuen Bedarf anpassen.
Sonst wird das nie was!
Wichtigste Frage: Wer ist also der wichtigste und empfindlichste Abnehmer unseres Heimnetzes?
Korrekte Antwort: Unser Streamer!
Egal, ob der von Auralic, Melco, Innuos, SotM, Silent Angel oder Prime Computer kommt. Egal, ob der “nur streamt” oder auch Roon kann.
Den Telefonen, den Faxgeräten, den Computern, unserer Smart-Home-Anlage …
… ihnen allen ist es absolut schnuppe, an welcher Stelle sie in unserem Netz an dasselbige angeschlossen sind. Sie alle brauchen “irgendwie” Kontakt – mehr nicht.
Unsere HiFi-Anlage gibt sich zwar ebenfalls mit einem „Kontakt“ zufrieden. Ihre Klangqualität wächst aber, wenn wir uns mit unserem Netz auf ihre Anforderungen einstellen.
Erster Schritt:
Die TAE-Dose muss in die Nähe der Anlage!
Wieso ist das so?
Feststellung 1 – der “letzte Meter”
Keine Ahnung, wieso das so ist, aber ob es sich um unsere Stromkabel handelt oder wie hier um die Telefon-/Netzwerkkabel – mit dem letzten Meter bestimmen wir die Klangqualität.
Genauer:
Wir dürfen ein günstiges Telefonkabel vom Telekom-Hauptanschluss kreuz und quer durchs Haus verlegen, ohne große klangliche Einbußen erwarten zu müssen.
Wenn (!!) – wir folgendes beachten:
Wir müssen dieses Telefonkabel in einer Ethernetdose enden lassen (Pin 4 und 5).
Von dieser Ethernetdose zur Fritzbox benutzen wir dann ein hochwertiges LAN-Kabel wie das audioquest Diamond oder das Furutech NCF LAN8.
Auf keinen Fall dürfen wir das Telefonkabel in einer üblichen TAE-Dose enden lassen. Und auch die Idee, ein “relativ gutes” Netzwerkkabel direkt in der Fritzbox enden zu lassen, ist keine gute!
Nochmal:
* Das billige Telefonkabel ziehen wir vom Anschlusskasten bis in die Nähe unserer HiFi-Anlage.
* Dort schließen wir es an eine LAN-Dose an.
* Von dieser LAN-Dose zur Fritzbox verwenden wir ein gutes LAN-Kabel.
Zusatz:
Wenn der Preis keine Rolle spielt, kann man natürlich auch vom Hausanschluss aus direkt ein richtig gutes LAN-Kabel zur Fritz!Box ziehen.
Und wie dicht darf die Fritzbox an der Anlage stehen?
Hierbei stehen sich zwei Ziele gegenüber:
A) Wir wollen die teuren Kabel so kurz wie möglich halten.
B) Die Fritzbox darf nicht in die Anlage einstrahlen
Bei einem Preis von 998,- € für 75 cm will man die Fritzbox so dicht an die Anlage stellen wie möglich.
Mit empfindlichen Phonoteilen oder Aktivboxen will man die Fritzbox so weit wie möglich von der Anlage entfernen. Ein Abstand von 2m dürfte beiden Forderungen gerecht werden.
Alternative mit noch besserem Klang? = Audiophiler Switch!
Mittlerweile haben sich die audiophilen Switches durchgesetzt. Dies hat mehrere Vorteile:
a) Mehr Ruhe und ein stabileres Klangbild.
b) Wir haben mehrere LAN-Anschlüsse innerhalb der HiFi-Anlage.
c) Die Fritz!Box darf jetzt wieder weiter weg von der HiFi-Anlage stehen und kann so nicht mehr einstrahlen.
d) Die Verbindung zwischen Fritz!Box und Switch können wir jetzt auch mit Glasfaser realisieren.
Im zweiten Schritt kümmern wir uns nun um Ihr weiteres Heimnetz.
Es ergeben sich nun zwei Alternativen:
Ohne audiophilen Switch befindet sich die Fritz!Box nun im Hörzimmer. Also müssen wir nun ein LAN-Kabel wieder zurück zu dem Punkt ziehen, an dem der Router vorher gestanden hat. Dort setzen wir nun einen einfachen Switch ein und verteilen das Heimnetz in alle benötigten Richtungen.
Mit audiophilem Switch können wir sogar die Fritz!Box dort im Flur oder im Keller lassen und ziehen jetzt eben nur unsere audiophile Verbindung zur HiFi-Anlage. Ob nun mit einem hochwertigen LAN-Kabel oder mit Glasfaser.
Was Sie sonst noch so tun können, um die Klangqualität in Ihrem Heimnetz zu verbessern, lesen Sie in weiteren Berichten hier auf meiner Seite.
Viel Spaß dabei! [...]
Lesen Sie weiter ...
12. Dezember 2021HiFi-HandbuchBi – Wiring – was genau steckt dahinter und was soll das eigentlich?
Die englische Bezeichnung “Bi-Wiring” steht für „zweifache Verkabelung“ und bezieht sich dabei auf die Verbindung zwischen Verstärker und Lautsprecher. Und nein, es sind nicht die beiden Kabel für rechts und links gemeint – und auch nicht die für rot und schwarz, sondern zwei vollständige Kabelsätze, also jeweils 2 x „roter“ und 2 x „schwarzer“ Leiter – für rechts und noch einmal 2 x „roter“ und 2 x „schwarzer“ Leiter für links.
(Wobei das mit den Farben jetzt nicht so ernst genommen werden muss!)
Nun gut – ich schaue mir meinen Verstärker mal von hinten genauer an.
Zu finden sind da jeweils rechts und links zwei Lautsprecher-Klemmen. Auf jeder Seite eine schwarze und eine rote Klemme.
Diese Klemmen können so genannte „Bananas“ aufnehmen, die man von hinten in die Buchsen steckt, oder aber Kabelschuhe, also solche U-förmigen Klemmen, die man mit diesen Buchsen so richtig festklemmen kann, oder man kann auch einfach lose Kabelenden in ein Loch im Gewinde schieben und ebenfalls festklemmen.
Aber – mehrere Möglichkeiten, ein Lautsprecherkabel aufnehmen zu können, die hat man ja wohl deshalb geschaffen, weil man nicht nicht wissen konnte, welche Anschlüsse die späteren Kabel haben werden – und nicht deshalb, damit man mehrere Kabel gleichzeitig anschließen kann, oder?
Und wozu auch? Weil ich mehr als ein Paar Lautsprecher anschließen will?
Das ist nicht ganz ungefährlich! Dadurch sinkt nämlich der Widerstand und das mögen viele Verstärker ganz und gar nicht!
Also ganz klar – je länger ich auf meinen Verstärker schaue, umso sicherer werde ich, dass ich mit einem zweiten Kabelsatz nichts anfangen kann.
Oder doch?
Schauen wir doch mal auf meine Lautsprecher.
Und siehe da!
Da finden sich doch tatsächlich zwei Paar Anschlussklemmen an jedem Lautsprecher!
Die beiden roten und die beiden schwarzen Klemmen sind jeweils mit einem Metallstreifen verbunden. Und auf dem Anschlussfeld finden sich die Aufschriften „Low“ und „High“.
Wenn ich diese Metallstreifen entferne, kann ich also tatsächlich einen Kabelsatz im Mittelhochton- und einen im Bassbereich einsetzen.
Aber – soll ich jetzt die beiden Kabelsätze am Verstärker an ein und dem gleichen Terminal-Paar anschließen? Brauche ich für so etwas nicht einen ganz anderen Verstärker oder gar ein Zusatzteil wie eine aktive Weiche?
Jede Logik muss uns doch sagen, dass an diesen Terminals am Verstärker „die ganze Musik“ anliegt, also sowohl die tiefen als auch die hohen Töne.
Und tatsächlich gibt es sogar solche „Weichen“ – aber stecken die nicht schon in den Lautsprechern?
Natürlich stecken sie in den Lautsprechern!
Genau so, wie bei der Eisenbahn die Weichenstellung bestimmt, welcher Zug in welche Richtung weitergelenkt wird, so kann eben auch eine Weiche bestimmen, welche Töne zum einen und welche zum anderen Ausgang geschickt werden.
Also, um mit Grönemeyers Worten zu sprechen: Was soll das?
Grundvoraussetzung dafür, sich überhaupt diesem Thema nähern zu können, ist die Anerkennung der These, dass die Musik-Informationen nur dann durch ein Kabel fließen, wenn sie auf der Lautsprecherseite auch eine „Arbeit“ zu verrichten, sprich: einen Treiber oder ein Chassis zu bewegen haben.
Ist das angesteuerte Chassis nicht in der Lage, bestimmte Frequenzen wiederzugeben, nehmen wir hier mal einen Hochtöner, der natürlich einen 100Hz-Ton nicht wiedergeben kann, dann fließt auch diese Frequenz mit 100 Hz und alles darunter gar nicht erst durch das Kabel.
Nehmen wir ein Bass-Chassis, das ab spätestens 200 Hz keinen Ton mehr von sich gibt, dann fließen durch das angeschlossene Kabel eben auch keine Frequenzen mehr ab 200 Hz aufwärts.
Weil sie keine „Arbeit“ zu verrichten haben.
Ein Einwand wäre jetzt zulässig, bei dem man darauf hinweist, dass ja im Lautsprecher eben so eine Weiche eingebaut ist, was möglicherweise bedeutet, dass ja doch alle Frequenzen, also z.B. auch die niedrigen zum Hochtöner geschickt werden.
Die hohen Frequenzen bewegen das Chassis, verrichten also ihre „Arbeit“ und die tiefen Frequenzen werden in der Weichenkonstruktion mit Spulen und Kondensatoren „vernichtet“.
Um in der Weiche vernichtet werden zu können, müssen sie ja aber auch erst einmal dort hin geflossen sein, oder?
Ein Einwand, den ich also nachvollziehen und auch nicht entkräften kann. Die Bi-Wiring-Theorie besagt jedoch beharrlich, dass nur die Frequenzen durch ein Kabel fließen, die vom Chassis auch genutzt werden. Alle anderen Frequenzen fließen eben nicht. Diese These verfolgt konsequent den Denkansatz, dass Weichen die ungenutzten Frequenzen nicht “vernichten”, sondern vielmehr “blockieren”. Damit dürften sie dann tatsächlich nicht fließen.
Dies bedeutet im Klartext:
Schließe ich ein Lautsprecherkabel an meinen Verstärker an und verbinde es mit einem Hochtöner, dann kann ich ein noch so bass-starkes Musikmaterial auflegen, durch das Kabel werden ausschließlich die hohen Frequenzen fließen und kein Bass!
Solange ich keinen Bass-Lautsprecher dazu anschließe – gibt es nur Höhen – Basta!
Und umgekehrt – schließe ich dieses Kabel an ein Bass-Chassis an, fließen eben keine hohen Frequenzen durch dieses Kabel.
So weit – so gut, gehen wir einmal davon aus, dass wir diese Theorie jetzt einfach so akzeptieren. Worin genau soll der Vorteil bei der Verwendung von zwei Kabeln liegen? Denn wissen wir nicht alle, dass Musik in der Regel sowohl aus tiefen als auch aus hohen Tönen, inklusive aller, die dazwischen liegen, besteht? Also müssen ja alle Frequenzen irgendwie vom Verstärker zum Lautsprecher gebracht werden!?
Da wir Menschen uns Strom irgendwie überhaupt nicht vorstellen können, man kann ihn ja weder sehen, noch riechen, noch hören – höchstens fühlen, aber meist halt nur ein mal – bleibt mir gar nichts anderes übrig, als hier „an den Haaren herbeigezogene“ Vergleiche anzubringen.
Nehmen wir also das Beispiel einer Rolltreppe.
Die effektive Fortbewegungsgeschwindigkeit einer Person, die auf einer Rolltreppe steht, entspricht der Geschwindigkeit mit der sich die Rolltreppe bewegt.
Läuft jemand auf der Rolltreppe selber mit, erhöht sich seine effektive Geschwindigkeit nach der Formel: Rollgeschwindigkeit plus Laufgeschwindigkeit = effektive Geschwindigkeit.
Das ist ja dann lustig, wenn eine Fliege im Überschallflugzeug von hinten nach vorne fliegt – dann fliegt sie nämlich effektiv schneller als das Flugzeug! 🙂
Läuft jemand der Rollrichtung entgegen, wird er effektiv deutlich langsamer und kann sogar rechnerisch Geschwindigkeiten im Minusbereich erreichen.
Wechselt er seine Laufrichtung immer wieder, verändert sich auch jedes mal seine effektive Geschwindigkeit.
Und jetzt stellen wir uns vor, die Rolltreppe selbst würde auch noch dauernd ihre Laufrichtung wechseln.
Zurück zum Musiksignal:
Ein tiefer 50 Hz-Ton wechselt pro Sekunde 50 mal die Flussrichtung. Dabei muss sehr viel „Strom fließen“, denn es gilt, ein großes, schweres Chassis anzutreiben.
Dieser 50 Hz-Ton übernimmt jetzt einmal in unserem Beispiel die Funktion der Rolltreppe und bewegt sich wie gesagt mit 50Hz immer hin und her.
Die Person in unserem Beispiel hat jetzt die Rolle eines 500 Hz-Tones zu übernehmen.
Er wechselt also sehr schnell seine Laufrichtung, so schnell, dass wir das mit unserem Auge nicht mehr wahrnehmen können und die „Wege“, die er zurücklegt, sind entsprechend kurz.
Mit anderen Worten: Wir sehen bei der Person praktisch keine Fortbewegung durch eigenes Laufen. Allerdings bewegt er sich im 50-Hz-Takt mal nach vorne, mal nach hinten.
Voran – kommt er damit nicht.
Und genau hier hakt dieses Beispiel.
Strom – also elektrische Signale müssen nicht „voran“ kommen, so wie eine Person auf einer Rolltreppe.
Strom bewirkt schon allein durch das „Hin und Her“ etwas.
Bei einem Wasserschlauch muss das Wasser aus dem Wasserhahn heraus durch den langen Schlauch hindurch fließen und kann dann vorne den Schlauch verlassen, um zum Beispiel unsere Blumen zu bewässern.
In einem Stromkabel und so auch in einem Signalkabel muss aber kein „Stromteilchen“ den ganzen Weg hindurch durch das Kabel fließen, um dann „hinten“ aus dem Kabel herauszufließen und dort eine Aufgabe zu erfüllen.
Damit Strom fließen kann, brauchen wir zwei Kabel, bzw. zwei Leiter oder Pole und die winzigste Hin- und Herbewegung bedeutet bereits, dass Strom fließt.
Mein Physiklehrer hat damals versucht, uns das mit einem Rohr zu verdeutlichen, das mit Kugeln gefüllt ist. Sobald ich an der einen Seite eine Kugel hineinstecke, fällt auf der anderen Seite eine heraus.
Nun – bei einem Lautsprecher fällt normalerweise zum Glück nichts heraus, aber lassen Sie mich an dieser Stelle auch zu der Funktionsweise eines konventionellen Lautsprechers etwas erläutern:
Man stellt sich am besten vor, wir halten in beiden Händen ein Band. Das linke Band ist vorne an einer Pappfläche befestigt. Das rechte Band ist an der Rückseite der Pappfläche befestigt, wird dann über eine Rolle ebenfalls nach vorne gelenkt und dort halten wir es in der rechten Hand.
Ziehen wir am linken Band, bewegt sich die Pappfläche nach vorne, ziehen wir am rechten Band, bewegt sie sich nach hinten.
Könnten wir jetzt 50 mal pro Sekunde unsere Zugrichtung ändern, hätten wir einen „mechanischen Lautsprecher“ gebaut, den wir sogar hören könnten.
In unseren elektrischen Chassis passiert genau solch ein Vorgang, nur dass der Verstärker nicht an Bändern zieht, sondern Strom zu den Chassis fließen lässt.
Dort gibt es dann eine Spule und einen Magneten. Fließt der Strom von plus nach minus bewegt sich das Chassis nach vorne, fließt er von minus nach plus, bewegt es sich nach hinten.
Und im Gegensatz zu uns ist ein Verstärker durchaus in der Lage, seine „Zugrichtung“ auch mehrere tausend mal pro Sekunde zu verändern.
Durch ein Signalkabel, also durch das Lautsprecherkabel fließen alle in der Musik vorhandenen Frequenzen gleichzeitig.
Finden Sie das nicht auch unglaublich?
Wie kann es sein, dass wir von einer Frauenstimme selbst die feinsten Details vernehmen können, obwohl gleichzeitig eine mächtige Bassunterstützung und große Pauken so „mächtige Ströme“ fließen lassen, dass doch eigentlich alle anderen Informationen „untergehen“ müssten?
Nun – das ist auch für mich nach wie vor immer noch ein Phänomen, dass ich mit meinem Kopf wohl niemals begreifen werde – aber es ist so. Unsere heutigen Geräte, die können das.
Aber geht das nicht besser?
Und genau da behauptet jetzt die Bi-Wiring-Theorie, dass wir das Klangbild verbessern können, wenn wir die hohen Töne von den tiefen Tönen getrennt durch zwei verschiedene Kabel leiten.
Ich für mein Teil muss sagen, dass ich das für das Logischste der Welt halte, eben weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das mit allen Frequenzen in einem Kabel überhaupt funktionieren kann und mir liegt die Frage auf der Zunge:
Reicht das denn überhaupt?
Wäre es nicht besser, noch viel mehr Kabelsätze einzusetzen?
Doch – immer mal langsam mit den jungen Pferden:
Wie viele Kabelsätze maximal sinnvoll sein können, bestimmt ja die Anzahl der Chassis in unserem Lautsprecher. Wenn ich nur zwei Chassis habe – was soll ich dann z.B. mit 10 Kabeln?
Das wäre ja dann so wie mit der Mülltrennung bei uns im Amt. Jeder bekommt drei Abfalleimer in drei unterschiedlichen Farben für drei unterschiedliche Abfallsorten. Die Reinigungskraft holt jeden Morgen alle drei Abfalleimer in den Flur und kippt die Inhalte in ein und dieselbe (!) große Tüte.
Doch selbst Lautsprecher mit drei oder mehr Chassis müssen nicht als Mehrwege-Lautsprecher konstruiert sein. Nicht die Anzahl der Chassis bestimmt nämlich die Anzahl der „Wege“ – dies übernimmt allein die Weiche.
Bi-Wiring richtet sich damit ausschließlich an Zwei-Wege-Boxen. Bietet der Lautsprecher drei Wege, so müsste man auch konsequenterweise Tri-Wiring betreiben.
Lassen Sie mich hier aber bei unserem Thema Bi-Wiring bleiben.
Die meisten Lautsprecher sind Zwei-Wege-Konstruktionen und damit eben geeignete Klienten für Bi-Wiring.
In der Praxis muss aber gesagt werden, dass nicht jeder Lautsprecher durch diese Maßnahme an Klang-Qualität gewinnt. Bei so manch einem ist das auch unmöglich.
So habe ich mal für einen Kunden die Innenverkabelung seiner Lautsprecher mit einem auf „Intelligenz zielenden“ Namen wechseln sollen. Diese Lautsprecher in halber „Telefonzellengröße“ wurden mit der Möglichkeit des Tri-Wiring-Betriebs beworben und hatten demnach an der Rückseite 3 Terminalpaare, die man auch noch einzeln schalten konnte.
Nachdem ich das Anschlussfeld herausgeschraubt hatte, offenbarte sich ein trauriges und überhaupt nicht intelligentes Bild: Alle drei Terminalpaare waren durch einen Draht miteinander verbunden. Völlig gleichgültig also, welches der Terminalpaare man verwendete, wie viele Kabel man benutzte und welche Schalterstellung man auch wählte – die tatsächliche Anschluss-Situation war immer identisch.
Dass der Besitzer einer solchen Box zwischen Single-Wiring, Bi-Wiring und selbst Tri-Wiring keine großen Unterschiede hören konnte, verwunderte nicht.
Allerdings gibt es auch hinreichend viele Beispiele für Lautsprecher, die im Bi-Wiring-Betrieb zu echten Höchstleistungen auflaufen.
Ob und wie ein Lautsprecher auf den Bi-Wring-Betrieb reagiert, dass hängt allein von seiner Konstruktion ab.
Nehmen wir als Beispiele die Elise I und die Pearl I aus meinem Lieferprogramm.
Während sich die Elise I durch Biwiring nicht noch weiter verbessern lässt, legt die Pearl I durch den Einsatz eines zweiten Kabelsatzes deutlich an Klangqualität zu.
Logischerweise bot der Hersteller die Elise I dann auch nicht mit Terminals für Bi-Wiring an.
Muss man zwei identische Kabelsätze verwenden oder dürfen es auch unterschiedliche Kabel sein?
Zugegeben – die Verlockung ist groß:
Der Bass ist schwammig?
Also nehme ich im Bassbereich ein Kabel, dass den Bass trockener und dünner werden lässt.
Die Höhen nerven?
Also nehme ich im Hochtonbereich ein Kabel, dass schöne, volle Höhen zaubert, oder?
Ja, sicher dürfen Sie das machen – es sind ja Ihre Lautsprecher, Ihre Kabel und es ist Ihr Geld!
Aber bei dieser Vorgehensweise muss man berücksichtigen, dass jedes Kabel eigene elektrische Parameter besitzt. Und wenn wir jetzt für den Bass und die Höhen unterschiedliche Kabel mit unterschiedlichen Parametern einsetzen, machen wir nichts anderes, als in die Weichenauslegung einzugreifen. Mit vollem Risiko! Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
Keine Angst – Sie können nichts „kaputt machen“ – außer: Den Klang!
Manchmal hören wir auf Anhieb, dass unsere Probleme beseitigt sind und freuen uns. Ein paar Tage später erkennen wir die neu hinzugekommenen Probleme, die regelmäßig unsere vorherigen Probleme übersteigen. Meine Empfehlung geht daher auf jeden Fall dahin, zwei identische Kabelsätze zu verwenden, oder zumindest zwei „ähnliche“ – vielleicht vom gleichen Hersteller.
Fazit:
Beim Bi-Wiring fließen die hohen und tiefen Frequenzen durch getrennte Kabel und manipulieren sich nicht mehr gegenseitig. Die Höhen werden nicht von den „großen Bass-Strömen“ beeinflusst und die Bässe klingen einfach sauberer – befreit von den „firlefanzigen“ Höhen.
Das alles funktioniert jedoch nur dann, wenn der Boxenentwickler die Weiche dafür ausgelegt hat. Wie so oft ist also mal wieder ausprobieren angesagt. [...]
Lesen Sie weiter ...
11. Dezember 2021HiFi-HandbuchNetzteile – Klang-Garanten ohne Anerkennung.
Mit diesem Bericht will ich Ihnen die Bedeutung dieser wichtigen Bausteine ein wenig näher bringen.
Netzstrom
Unser Energielieferant versorgt uns hier in Deutschland mit 230 Volt Wechselstrom. Doch kaum ein Elektrogerät funktioniert tatsächlich mit diesem Wert. Oft reichen schon 12V oder 15V, um das eigentliche Gerät damit zu betreiben. Also müssen wir den Strom auf diese geringeren Werte herunter-transformieren.
Wir brauchen einen Trafo (Transformator)
Um von 230V auf diese niedrigere Spannung zu kommen, brauchen wir so einen Trafo.
Das sind zwei Spulen auf einem Eisenkern. Fließen die 230V durch die eine Spule, wird auch eine Spannung in der zweiten Spule erzeugt. Der dabei entstehende Wert ist abhängig von der Anzahl der Wicklungen, die diese Spule hat. Je nachdem, wie oft wir also unseren Draht um den Eisenkern wickeln, erhalten wir am Ende 12V, 15V oder irgend einen anderen Wert, den wir benötigen.
Es war einmal …
Doch dieses Verfahren findet man heute nur noch selten. Es hatte nämlich den gravierenden Nachteil, auch dann Strom zu verbrauchen, wenn die angeschlossenen Geräte gar nicht benutzt wurden.
Schaltnetzteile – die optimale Lösung!?
Abhilfe schaffen, sollten und konnten die so genannten Schaltnetzteile. Durch entsprechende Standardisierung (auch wenn uns das völlig anders erscheint) und durch die hohen gefertigten Stückzahlen konnten die Kosten für diese Netzteile erheblich gesenkt werden. Und sie haben zudem den Vorteil, kaum Strom zu verschwenden, was ja schon mal toll ist und unser schlechtes Umweltgewissen beruhigt.
Allerdings sind so einige Leutchen mit diesen einfachen Schaltnetzteilen überhaupt nicht zufrieden.
Miese Qualität
Wenn ein Einkaufspreis von 1,50 € immer noch gedrückt werden muss, dann muss man sich nicht wundern, wenn diese Teile schon verschmoren, bevor das Elektrogerät überhaupt in Betrieb genommen werden konnte. (Habe ich selbst bei einem Scanner erlebt)
Die Leistung bricht in sich zusammen
Messen wir die Ausgangswerte während kein Gerät angeschlossen ist, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch das ändert sich nicht selten, sobald das zu betreibende Gerät diese Leistung einfordert. Manchmal ist das nicht so schlimm, wenn z.B. eine kleine Lampe nicht ganz so hell leuchtet wie sie es könnte, aber manchmal merken wir das doch, weil die Maschine dann instabil läuft und keine rechte Kraft entwickeln kann.
Und wieder ein anderes mal klingt es einfach nur nicht so gut und kein Mensch kommt auf die Idee, dass das Netzteil der Schuldige sein könnte.
Schlechtes Netzteil – schlechter Klang
Betreiben wir ein HiFi-Gerät mit so einem instabilen Netzteil, dann kann das schon mal schnell für einen richtig schlechten Klang sorgen. Um ein Orchesterwerk oder einen dynamischen Rock-Song mit all seiner Dynamik reproduzieren zu können, ist mal weniger und mal mehr Strom erforderlich. Das Netzteil muss in den leisen Passagen für „Ruhe“ im Klangbild sorgen und in den lauten eben entsprechend schnell und viel Strom liefern können.
Ohne Input kein Output
Bricht die Stromversorgung ein, kann die Komponente nicht optimal funktionieren. Aus einem mitreißenden, dynamischen Musikstück wird dann ein langweilig dahinplätscherndes Etwas.
Die Reinheit des Klangs
Doch das ist nicht das einzige Problem dieser Standard-Netzteile. Das zweite Problem ist, dass sie funktionsbedingt selbst Störungen erzeugen und diese in unser Stromnetz einspeisen. Diese Störungen mögen sich nach den ersten Metern durch unsere Leitungen mit all dem anderen „Elektromüll“ vermischen und dann für sich gar nicht mehr auffallen, aber steckt so ein Billig-Netzteil in der Verteilerleiste unserer Stereoanlage – weil es z.B. zu einem Plattenspieler, einem Internetradio oder gar einer Halogenlampe gehört – dann sollten wir schnell damit aufhören, unser Geld in bessere Komponenten zu stecken und stattdessen erst einmal diesen Störer beseitigen.
Musikgeräte „funktionieren“ nicht nur mit Strom, sie arbeiten mit Strom!
Es besteht ein gravierender Unterschied zwischen Geräten, die Strom einfach nur dafür brauchen, um zu funktionieren, also z.B. sich zu drehen oder zu leuchten …
und Geräten, die aus Strom Musik entstehen lassen.
Es ist ganz wichtig – dass Sie diesen Unterschied begreifen!
Musikgeräte brauchen nicht nur Strom, damit man sie einschalten kann.
Musik-Komponenten arbeiten mit Strom als „Ausgangs-Material“.
Musikgeräte verarbeiten Strom wie ein Töpfer Ton verarbeitet, wie ein Maler Farbe verarbeitet.
Musikgeräte erhalten die Musik-Informationen in Form von Stromsignalen. Sie lesen die Musik aus dem Strom heraus, verstärken die erkannten Signale, wandeln sie um und leiten sie wieder als Stromsignale an die nachfolgenden Geräte weiter.
Störungen sind auch Signale!
Und ihre Werte liegen manchmal im gleichen Bereich, wie die Musiksignale selbst.
Wie soll die nachfolgende Komponente nur „wissen“, was von den ankommenden „Signalen“ Musik ist und was Störungen sind?
Eine intelligente Komponente, die das unterscheiden kann, die gibt es noch nicht.
Unsere Aufgabe liegt also darin, die Störungen gar nicht erst zu erzeugen oder sie nicht zu unserer Stereoanlage durchdringen zu lassen.
Filter als Lösung?
Filter sind eine mögliche und beliebte Vorgehensweise. Zu diesem Thema lesen Sie bitte an anderer Stelle in diesem Buch weiter. (Artikel noch nicht online)
Leistungsfähige, stabile und „saubere“ Netzteile
Die so genannten audiophilen Netzteile kommen gerade in „Mode“. Doch neu – sind sie ganz und gar nicht.
Wären Sie bereit, sich ein Gerät für 250,- € zu kaufen und für das benötigte Netzteil 2.750,- € zu bezahlen? Niemals, oder?
Und was ist, wenn ich Ihnen sage, dass Sie das möglicherweise schon längst getan haben!?
Lassen Sie mich die Tiefe dieses Themas mal an einem recht beeindruckenden Beispiel erläutern.
Extrem-Beispiel aus der Realität
In den 80-er und 90-ger Jahren handelte ich mit den Geräten einer teuren amerikanischen Marke und da gab es Mono-Verstärker (von denen man also zwei Stück brauchte) mit sehr imposantem Erscheinungsbild.
Fast 60 cm hoch, 50 cm tief, 30 cm breit und mit einem Versandgewicht von gut 100 kg.
Zu dieser Zeit haben sie rund 60.000,- DM pro Paar gekostet.
Sie hätten damals mal dabei sein sollen, wenn der Cheftechniker des deutschen Vertriebs eine kleine Platine (etwa 15 x 15 cm) aus einer der Endstufen zog und erklärte, dass das jetzt die „Audio-Platine“ sei.
Wer dann erstaunt auf diese „Heizkörper“ schaute und fragte, was denn dann der Rest sei, bekam zur Antwort: „Der Rest ist das Netzteil. Es kümmert sich darum, den Strom stabil und sauber zu machen.“.
Natürlich stimmte das nicht so zu Hundert Prozent, aber es traf die Aussage sehr genau, die ich hier gerne tätigen möchte.
Zwei Netzteile für 55.000,- DM
Wenn wir nämlich mal dieser „Audio-Platine“ unterstellen, vom Allerfeinsten gewesen zu sein und einen Gegenwert von 2.500,- DM/Stück besessen zu haben, blieben also 55.000,- DM übrig, die in „die beiden Netzteile“ geflossen sind.
So darf man das nicht sehen!?
Natürlich konnte man die Teile nicht getrennt voneinander kaufen und auch nicht betreiben. Das alles war eben “ein Gerät” und niemand kam auf die Idee, die Bausteine getrennt zu betrachten.
Um Verständnis werben
Ich möchte mit dieser kleinen Geschichte auch lediglich erreichen, dass Sie mehr Verständnis für die Bedeutung von Netzteilen aufbringen.
Das Denken ist uns Menschen manchmal ganz schön im Weg.
Während ein Netzteil im gleichen Gehäuse kosten darf was es will und muss, sollte ein Netzteil im getrennten Gehäuse nach der Meinung vieler mit 10,- € doch gut bezahlt sein, oder?
Was sollte ich als Musikliebhaber tun?
Erster Schritt:
Verbannen Sie alle Netzteile, die Sie für die Stereo-Anlage nicht zwingend benötigen, aus der Nähe der Anlage. Ihre Plattenspielerbeleuchtung mag ja noch so stylisch aussehen – wenn sie aber über so ein billiges Schaltnetzteil (intern oder extern) betrieben wird, ist das nicht gut!
Also alles, was an Netzteilen nicht unbedingt benötigt wird, das muss ganz weit weg von der Stereo-Anlage betrieben werden – wenn überhaupt.
Zweiter Schritt:
Bei den Geräten, die sie weiter betreiben möchten/müssen, ersetzen Sie diese kleinen Standard-Netzteile durch spezielle Netzteile, die aus audiophiler Sicht entwickelt wurden. Hierbei geht es zwar primär darum, die mit diesen Netzteilen betriebenen Geräte klanglich zu verbessern, aber das Ziel, mit einem besseren Netzteil keine oder weniger Störungen zu erzeugen ist nicht weniger von Bedeutung.
Und was nimmt man da nun?
Ein paar Beispiele für gute Netzteile und deren klangliche Auswirkungen finden Sie in meinem aktuellen Netzteile-Vergleichsbericht.
Zum Netzteil-Hörbericht.
[...]
Lesen Sie weiter ...
5. Dezember 2021HiFi-HandbuchSkating und Antiskating beim Plattenspieler
Haben Sie schon mal einen Bericht über die Skatingkraft lesen wollen, ihn dann aber angesichts der vielen komplizierten Formeln gleich wieder beiseite gelegt?
Willkommen im Club!
Von den meisten Erklärungen, die ich bisher so lesen konnte, habe ich nicht viel verstanden. Was wohl hauptsächlich daran liegt, dass ich sie für “ziemlich falsch” halte.
Wenn mir nämlich jemand erklären will, dass die Skatingkraft dadurch entsteht, dass die Reibung der Abtastnadel an der inneren Rillenflanke der Schallplatte größer ist als die an der äußeren Flanke, dann beschreibt er damit zwar eine Auswirkung, verschweigt aber deren Ursache.
Eine Skatingkraft, die durch die unterschiedlichen Reibungskräfte an den Rillenflanken erzeugt wird, die gibt es jedenfalls nicht!
Es soll die Skatingkraft nicht geben?
Finden wir nicht Berichte über sie in Hülle und Fülle – auch in wirklich ernst zu nehmenden, geradezu “wissenschaftlichen” Fachbüchern und natürlich auch bei Wikipedia?
Nun – das stimmt durchaus.
Doch hat uns diese Wissenschaft nicht schon viel größere Irrtümer beschert!?
Ein einziger falscher Rückschluss und schon war der gesamten westlichen Welt in den 60-er Jahren eine Glutamat-Unverträglichkeit bescheinigt worden, die bis heute nicht bestätigt werden konnte!
Eine ähnlich „verunglückte“ Auswertung hat aus meiner Sicht immer wieder bei der Betrachtung der Skatingkraft stattgefunden.
Nicht wenige bezweifeln deshalb diese Behauptungen und bauen die Antiskating-Vorrichtungen an Ihren Tonarmen wieder ab oder statten sie gar nicht erst damit aus.
Aber auch das ist falsch!
Weil es ohne eine korrekt eingestellte Antiskatingkraft zu Verzerrungen kommen muss!
Doch wieso brauchen wir eine Antiskatingkraft, wenn es die Skatingkraft gar nicht gibt?
Ganz einfach:
Weil es durchaus Kräfte gibt, die seitlich auf den Tonarm einwirken. Nur kommen sie nicht von der unterschiedlichen Reibung an den Rillenflanken, sondern diese unterschiedliche Reibung resultiert daraus.
Gehen wir der Angelegenheit doch mal systematisch auf den Grund:
Skating – was heißt das denn überhaupt?
Skating ist das englische Wort für Schlittschuhlaufen und darf wohl als Synonym für das „Gleiten über eine Oberfläche“ betrachtet werden. Mit oder ohne Rillen.
Namen sind Schall und Rauch und Skating passt gut zu dem, was tatsächlich geschieht, also bleibe auch ich in diesem Beitrag bei dieser Bezeichnung.
Damit wir erkennen können, was für Kräfte tatsächlich auf einer sich drehenden Schallplatte auftreten, habe ich mal ein kleines Demonstrations-Video gedreht. Nein, ein Spielberg ist sicher nicht an mir verloren gegangen, aber es sollte doch zu erkennen sein, was ich demonstrieren will.
Auf meinem guten alten Philips 504 dreht sich eine ausrangierte, mehr oder weniger “glatte” Antiskating-Mess-Schallplatte.
An einem Ende eines Bambus-Stabs habe ich ein Loch gebohrt und dort einen Faden hindurch gezogen. Mit diesem Faden habe ich den Stab in einen Halter eingespannt, so dass sich der Stab seitlich frei bewegen kann. Ich hätte das auch einfacher demonstrieren können, indem ich den Stab zwischen Daumen und Zeigefinger halte, aber ich befürchtete, danach zum zweiten Uri Geller erklärt zu werden und habe mich lieber mal für den Faden entschieden. 🙂
In dem Video kann man folgendes erkennen:
Es gibt auf der sich drehenden Scheibe drei Zonen, die unterschiedlich auf den Tonarm einwirken.
In der Mittel-Linien-Zone (Zone 1) bleibt der Tonarm/Stab dort stehen, wo er abgesetzt wird. Es gibt dort keine seitlich wirkenden Kräfte, also auch keine Skatingkräfte.
In der unteren Zone (Zone 2) wird der Tonarm/Stab nach links gezogen.
In der oberen Zone (Zone 3) wird der Tonarm/Stab nach rechts geschoben.
Zum Video “Skatingkraft” anklicken:
Skatingkraft
Wird der Tonarm “nach links” gezogen, versucht er dieser Zugkraft zu folgen. Da er aber an seinen Lagerpunkt “gefesselt” ist, kann er der Schallplatte nicht folgen – er kann sich nur um seinen Lagerpunkt drehen. Die Kurve, die er hierbei beschreibt, führt ihn automatisch zum Schallplatten-Mittelpunkt und es sieht so aus, als würde der Tonarm zum Mitteldorn hin gezogen werden.
Befindet sich der Tonarm in der Zone 3 und wird er nach “rechts” geschoben, beschreibt er wieder nur die ihm bestimmte Kurve um seinen eigenen Drehpunkt und dreht sich damit nach außen zum Schallplattenrand hin.
Beide Bewegungen sind dem Lagerpunkt des Tonarmes geschuldet und haben nicht wirklich etwas mit “innen” und “außen” zu tun. Liegt der Tonarm/Stab exakt auf der parallelen Mittellinie auf, gibt es überhaupt keine seitlich einwirkenden Kräfte.
Hier eine Skizze zur Definition der parallelen Mittel-Linie.
Bitte montieren Sie Ihren Tonarm nicht so, dass die Nadel die Schallplatte auf der parallelen Mittellinie berührt. Die sich hierdurch ergebende, äußerst schlechte Tonarmgeometrie verhindert, dass die Nadel der Rille folgen kann und irgendwas geht dabei ganz bestimmt kaputt!
Zwischenfazit:
Es gibt auf der Schallplatte drei Zonen mit unterschiedlichen seitlich wirkenden Kräften auf den Tonarm.
Damit müssen wir aber jetzt zu der folgenden Frage kommen:
Wo ist denn der geometrisch günstigste Montagepunkt für einen Tonarm?
Da dieses Thema sehr umfangreich ist, finden Sie eine genaue Anleitung zur Tonarm-Montage und zur Tonabnehmer-Justage jeweils in einem eigenen Beitrag.
So viel sei aber an dieser Stelle verraten:
Bei einem korrekt justierten Tonarm trifft die Abtastnadel die Schallplatte im Bereich der zweiten Zone – also in der Zone, in der der Tonarm nach links gezogen wird. Sein Lager zwingt ihn in Richtung Plattenmitte. Auf einer glatten Schallplatte wie in meinem Video würde der Arm also sofort zur Plattenmitte gleiten.
Bei einer normalen Schallplatte geht das aber nicht, weil die Nadel “tief in der Rille” steckt und über die innere Rillenflanke nicht hinweg kommt. Allerdings drückt die Nadel nun gegen die innere Flanke und erzeugt damit eine hohe Reibung.
Der Druck auf die äußere Rillenflanke ist dementsprechend geringer.
Genau hier treffe ich mich also wieder mit allen, die behaupten, die Reibungskräfte an den Rillenflanken seien unterschiedlich stark.
Nur ist das eben eine Folge und keine Ursache.
Wie dem auch sei, eines steht fest:
Wir müssen diese starke Reibung an der inneren Rillenflanke durch eine Gegenkraft ausgleichen.
Es besteht nämlich die akute Gefahr, dass der Druck des Diamanten gegen die äußere Rillenflanke zu schwach wird, um dafür zu sorgen, dass die Nadel den Kontakt zu ihr halten kann. Verliert sie ihren engen Kontakt, kann sie die Information nicht mehr sauber lesen. Stattdessen schwebt die Nadel mit der äußeren Flanke zeitweise “in der Luft”.
Hören können wir das deutlich, denn es äußert sich in Form von Verzerrungen im rechten Kanal, da die äußere Rille das Signal für den rechten Kanal in sich trägt.
Um genau das zu verhindern und die Zugkraft der sich drehenden Schallplatte auszugleichen, gibt es die Antiskating-Vorrichtungen, die wir auch tunlichst benutzen sollten.
Doch welche Anti-Skating-Vorrichtungen gibt es eigentlich und was taugen sie?
Um eine Bewertung vornehmen zu können, müssen wir uns zunächst folgendes vor Augen führen:
Es gibt einige Parameter, die die Auswirkungen der Skatingkraft beeinflussen:
a) Die Zugkraft-Stärke der sich drehenden Schallplatte.
Sie wird durch den Abstand der Abtastnadel zur parallelen Mittellinie (Zone 1) hin bestimmt. Je weiter entfernt von der parallelen Mittel-Linie sich die Nadel in der unteren Zone (Zone 2) befindet, um so stärker ist die Zugkraft nach links.
Ein gut justierter Tonarm befindet sich etwa in der Mitte der modulierten Fläche (die Fläche mit der Musik drauf) am weitesten von der parallelen Mittellinie entfernt, weshalb hier die “Skatingkraft” am größten ist.
b) Die Fähigkeit des Tonarms, der Zugrichtung nach links zu folgen.
Am Außenrand der Schallplatte kann der Tonarm noch relativ leicht der Zugkraft der Schallplatte nach links folgen. Je weiter er sich der Plattentellermitte nähert, umso schwerer fällt es ihm, weil er immer weniger nach links und immer stärker nach oben wandern will.
c) Die korrekte 90°-Stellung zur Rille
Ein korrekt justierter Tonarm (siehe Beitrag zur Tonarmjustage) steht in zwei Bereichen der Schallplatte genau im richtigen Winkel zur Rille. Hier gleitet die Nadel dann auch mit dem geringsten Widerstand durch die Rille. In allen anderen Bereichen wirkt sich die Abweichung vom korrekten Winkel auch auf die Skatingkräfte aus.
d) Die Auflagekraft
Je größer der Druck der Abtastnadel auf die Schallplatte ist, um so stärker wirken sich auch die seitlichen Kräfte auf den Tonarm aus. Weshalb die allgemeine Empfehlung dahin geht, die Antiskatingkraft analog zur Auflagekraft einzustellen. Man kann aber bei Tonabnehmern mit ungewöhnlich hohen Auflagekräften (z.B. 5 gr.) wieder feststellen, dass sie auch mit weniger starker Antiskatingkraft korrekt abtasten.
e) Die Gleit-Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit, mit der die Abtastnadel durch die Rille gleitet, ist außen natürlich deutlich höher als kurz vor der Auslaufrille. Mit der Geschwindigkeit steigt auch die Skatingkraft, weshalb sie außen stärker ist als innen.
f) Die waagerechte Aufstellung des Plattenspielers
Steht der Plattenspieler selber nicht “im Wasser”, wirkt sich das auch auf die Skating- und die Antiskatingkraft aus. Da es sich bei einem Tonarm um eine fast “ausgewogene Wippe” handelt mit leichtem Schwergewicht zum Tonabnehmer hin, kann man manchmal gar nicht voraussehen, wie sich eine Schrägstellung des Plattenspielers auswirken wird. Um zu verhindern, dass wir in einen experimentellen Bereich hineingeraten, sollte die waagerechte Aufstellung des Plattenspielers eine Grundvoraussetzung für die Tonarmjustage sein.
g) Tonarmlänge
Mit der Länge des Tonarms verbessert sich die Geometrie und die Spurfehlwinkel werden immer kleiner. Auch dies wirkt sich auf die Skatingkraft aus.
Zusammenfassung:
Die seitlich auf den Tonarm wirkenden Kräfte sind von verschiedenen Parametern abhängig und verändern sich während des Abspielvorgangs.
Es kann beobachtet werden, dass die Skatingkraft im Gesamtergebnis zur Schallplattenmitte hin kontinuierlich abnimmt. Außen ist sie also stärker, nach innen hin wird sie schwächer.
Diese Aussage führt uns zu der Erkenntnis, dass alle Antiskating-Lösungen, die mit einer Feder arbeiten, exakt umgekehrt zur tatsächlichen Entwicklung arbeiten. Außen ist die Feder noch schwach gespannt – nach innen hin spannt sie sich immer stärker. Sie entwickelt sich also entgegengesetzt zur Skatingkraft. Hier bleibt uns nur zu hoffen, dass sich der Tonarmhersteller dieser Tatsache bewusst war und eine Federkonstruktion gewählt hat, deren Kraftentwicklung zu vernachlässigen ist.
Besser sind diese Lösungen mit den “baumelnden Gewichten”, da diese Gewichte eben über den gesamten Bereich gleich bleiben und sich damit schon mal nicht entgegengesetzt zur Skatingkraft entwickeln.
Noch passender sind Lösungen, bei denen die Gewichte auf einer Hebelkonstruktion angebracht sind. Befindet sich der Tonarm außen am Rand der Platte, schwebt der Hebel mit dem Gewicht in der Waagerechten. Damit befindet er sich in der größten Entfernung zu seinem Lagerpunkt und zieht am stärksten.
Je weiter der Tonarm nun nach innen wandert und an der Konstruktion zieht, stellt sich der Hebel mit dem Gewicht immer senkrechter. Das Gewicht nähert sich immer mehr seinem Lagerpunkt und seine Zugkraft wird damit immer geringer. Wenn man jetzt auch noch mit unterschiedlich hohen Gewichten arbeiten kann, dürfte einer korrekten Anti-Skating-Einstellung nicht mehr viel im Wege stehen.
Hier eine kleine Skizze zur Funktion dieser “Hebelgewichte”:
Alternative Lösungen:
Es gab die unterschiedlichsten Ansätze, um die Aufgabe noch besser zu lösen. Mit Elektromagneten wurde experimentiert, aber durchsetzen konnten sie sich nicht. Was einfach daran liegt, dass diese Magnete ja auch nur “irgendwie eingestellt” werden können. Damit Sie zu jeder Zeit korrekt wirken können, müssten erst Sensoren entwickelt werden, mit denen die tatsächliche Stärke der Skatingkraft mit samt der oben genannten Parameter gemessen und ausgewertet werden könnten.
Wie wichtig ist die korrekte Antiskating-Einstellung denn überhaupt?
Die Antwort ist ziemlich einfach:
Solange Sie keine Verzerrungen hören, weder im rechten noch im linken Kanal, ist alles in Ordnung und Sie brauchen überhaupt nichts zu verändern!
Stellen sich die Verzerrungen in beiden Kanälen gleichzeitig ein, so hat das nichts mit der Antiskating-Einstellung zu tun. Möglicherweise ist die Auflagekraft falsch eingestellt oder Tonabnehmer und Tonarm passen nicht zusammen.
Verzerrt es jedoch nur in einem Kanal, dann sollten Sie die Antiskating-Einstellung korrigieren, bevor Ihre Schallplatten Schaden nehmen.
Verzerrt es im linken Kanal – dann ist die Antiskating zu stark eingestellt – senken Sie den Wert ab!
Verzerrt es im rechten Kanal – dann ist die Antiskating zu schwach eingestellt – erhöhen Sie den Wert!
Kann man die Einstellung messen oder prüfen?
Es gibt eine Reihe von Mess- und Einstell-Schallplatten. Zum Teil arbeiten sie nur mit Ihrem Gehör, es gibt aber auch welche, zu denen eine Software gehört. Damit können Sie dann auch deutlich mehr messen als nur die korrekte Anti-Skating-Einstellung.
Tipp:
Trauen Sie Ihren Ohren – solange alles gut läuft und nichts verzerrt – lassen Sie die Antiskating-Einstellung so wie sie ist und sparen Sie sich die Mess-Schallplatten. [...]
Lesen Sie weiter ...
5. Dezember 2021HiFi-HandbuchAzimuth beim Tonarm
Der Begriff Azimuth beim Tonarm steht für den „rechten Winkel“, in dem ein Tonabnehmer zur Schallplattenoberfläche stehen sollte, wenn wir uns die Headshell von vorne betrachten.
Die korrekte Azimuth-Einstellung ist aber ein viel tiefer greifendes Thema, als es die Skizze erkennen lässt.
Sind sowohl Laufwerk,Tonarm als auch Tonabnehmer absolut präzise angefertigt worden, bedarf es eigentlich keiner Möglichkeit zur Azimuthverstellung. Jedes beteiligte Bauteil sollte im Lot, bzw. im Wasser stehen und jede Diskussion über falsch oder richtig damit überflüssig sein.
Doch was kann hier nicht alles passieren!?
Laufwerk
Hier lautet die entscheidende Frage, ob das Chassis an der Stelle, an der die Tonarmbasis montiert ist, parallel zur Plattentelleroberfläche verläuft. Und das ist nicht so selbstverständlich wie es einem auf den ersten Blick erscheinen mag!
Sind Tonarm und Plattenteller-Lager auf dem gleichen „Brett“ montiert, sollte man davon ausgehen können, dass sie parallel zueinander stehen.
Aber ist der Plattenteller auch wirklich „flach“ oder ist er ein wenig „schüsselförmig“?
Manche Plattenteller werden mit einer kleinen Erhöhung am Rand versehen. Meistens gehört nun ein Plattengewicht dazu. Legt man die Platte ohne Gewicht auf den Teller, liegt sie lediglich außen am Rand auf dieser Erhöhung auf und man kann bei einer leicht verwellten Platte erkennen, dass hier und da eine Lücke zwischen Rand und Platte besteht.
Kommt nun das Gewicht zum Einsatz, wird die Schallplatte rundherum gegen diesen Rand gedrückt und liegt nun überall fest an. Schneiden wir aber diese Konstruktion gedanklich in der Mitte durch, werden wir feststellen, dass sich die Platte im äußeren Bereich nach oben biegt und dadurch eine leichte Schüsselform angenommen hat.
Andere Plattenteller (z.B. bei früheren Audio Exclusive-Granitlaufwerken) sind komplett schüsselförmig gearbeitet – bis zur Lagermitte hin.
Eine weitere durchaus interessante Variante bot und bietet uns VPI. Hier ist der Plattenteller plan. Um die Mittelachse herum liegt jedoch eine Gummischeibe. Legt man nun eine Schallplatte auf, liegt sie vollständig „hohl“ zum Plattenteller hin und wackelt auf der kleinen Gummischeibe hin und her.
Die Mittelachse hat jedoch ein Außengewinde, dazu gehört ein Puck und eine runde Rändelmutter aus Kunststoff. Dieser Puck ist an der Unterseite schüsselförmig ausgeführt. Wenn wir den Puck auflegen und ihn mit der Kunststoffmutter anziehen, drückt er nur mit seinem äußeren Rand auf die Schallplatte und zwingt sie so zunächst ebenfalls in eine Schüsselform nach unten. Dadurch legt sich selbst eine verwellte Platte außen glatt auf den Plattenteller. Wenn wir den Puck nun weiter anschrauben, bekommt die Schallplatte über eine immer größer werdende Fläche Kontakt zum Plattenteller und liegt dann wieder plan und waagerecht.
Mit einer alten Schallplatte können wir das gut kontrollieren, indem wir immer wieder mit unserem Fingernagel oder einem kleinen Gegenstand auf die Platte klopfen. Klingt es hohl, müssen wir den Puck noch fester anziehen. Erst wenn die gesamte Fläche mit der Musikinformation fest auf dem Plattenteller aufliegt, haben wir das korrekte Drehmoment erreicht. Sobald wir gelernt haben, wie fest wir den Puck anziehen müssen, können wir das auch mit unseren guten Schallplatten machen.
Und wenn der ganze Plattenteller schief steht?
Doch was nutzt die beste Plattenteller-Konstruktion, wenn der Plattenteller nicht parallel zum Chassis steht?
Es gibt da zum Beispiel ein Laufwerk, dessen Holz-Chassis einen „Schnitt“ verpasst bekommen hat. Dieser Schnitt verläuft um das Plattentellerlager herum und soll dazu dienen, die Resonanzen des Lagers und die im Tonarm nicht zueinander finden zu lassen.
Zum einen widerspricht es damit meiner persönlichen Theorie des Resonanzkreislaufs (habe ich an anderer Stelle bereits erläutert) zum anderen passiert aber nach einiger Zeit folgendes:
Diese „Halbinsel“, auf der der Plattenteller samt Lager montiert ist, sackt nach unten ab. Damit steht sie nicht mehr parallel zum Chassis und zur Tonarmbasis. Wie wir dieses Laufwerk auch justieren, entweder steht der Plattenteller im Wasser oder die Tonarmbasis. Beides geht nicht!
Schief stehender Plattenteller und mögliche Ursache
In all diesen Fällen und sicher gibt es da noch einige Gründe für einen schief stehenden Teller mehr, kommen wir nicht umhin, den Azimuth an die Plattenoberfläche anzupassen.
Tonarm
Wird ein Tonarm ohne Azimuth-Verstellmöglichkeit ausgeliefert, der nicht korrekt im Lager sitzt, können wir lange nach einer Abhilfe suchen – eine praktikable Lösung werden wir nicht finden.
Aber auch die Basis, also die Stelle, an der der Tonarm montiert ist, kann ein wenig schief stehen. Manchmal ruht der Arm auf einem „Ausläufer“, der nicht ganz parallel zur Plattenoberfläche verläuft. Bevor wir so eine schiefe Basis mit der Azimuth-Einstellung auszugleichen versuchen, sollten wir aber zunächst prüfen, ob sich die Basis nicht richten lässt, denn jede eigentlich unnötige Azimuth-Abweichung löst nur neue Probleme aus.
Tonabnehmer
Hier gibt es gleich mehrere Stellen, an denen möglicherweise nicht ganz korrekt gearbeitet worden sein kann. Die offensichtlichste Möglichkeit ist, dass der winzig kleine Diamant nicht ganz senkrecht eingebaut worden ist. Die nächste Ungenauigkeit kann sich bei der Fixierung des Nadelträgers ergeben haben.
Aber auch das gesamte „Innengebilde“ aus Nadelträger, Spulen und Magneten kann in sich „schief“ eingebaut worden sein. Jeder, der schon mal mit Magneten „gespielt“ hat, der weiß, dass sie nicht ganz einfach zu handeln sind.
Und dann gibt es noch eine ganz einfach Erklärung für einen optisch „schiefen“ Tonabnehmer:
Weil sich der Hersteller an seine Messergebnisse gehalten und den Tonabnehmer optimiert hat.
Messung über Optik?
Es gibt keine zwei absolut identische Magnete und auch keine zwei absolut identische Spulen. Ganz sicher haben sie alle eng gesteckte Toleranzen einzuhalten, aber völlig identisch sind sie nie.
Mit unseren Augen können wir solche Unterschiede nicht erkennen, auch nicht unter dem Mikroskop. Aber es gibt Messgeräte, die uns viel verraten können.
Doch was genau ist das Ziel solcher Messungen?
Nehmen wir als Beispiel die Endjustage eines MC-Systems.
MC steht hier für Moving-Coil, also für „bewegte Spule“. Dies bedeutet, dass sich auf dem Nadelträger Spulen befinden. Gleitet der Diamant durch die Rille, bewegt sich der Nadelträger und damit bewegen sich die Spulen. Da sich die Spulen innerhalb eines Magnetfeldes befinden, wird eine elektrische Spannung erzeugt.
Das erste Ziel …
eines Tonabnehmer-Entwicklers lautet, eine möglichst hohe Ausgangsspannung zu erhalten. Dies gelingt nur an der Stelle, an der das Magnetfeld am stärksten ist. Er wird also bei der Justage des Nadelträgers versuchen, den Lagerpunkt an der richtigen Position innerhalb des Magnetfeldes zu fixieren.
Das zweite Ziel …
ist, für beide Kanäle den gleichen Pegel zu erreichen. Es ist nicht akzeptabel, wenn ein Kanal lauter ist als der andere.
Das dritte Ziel …
ist die Verhinderung des „Übersprechens“, also die Optimierung der Kanaltrennung.
Was im linken Kanal zu hören ist, das soll auch im linken Kanal bleiben. Ebenso sind unsere Ansprüche an den rechten Kanal.
Es ist leicht zu erkennen, dass die Messergebnisse möglicherweise gegensätzliche Optimierungsmaßnahmen einfordern, die den Hersteller zwingen können, sich entscheiden zu müssen.
Solange er nur das „Opfer“ bringen muss, dass der Nadelträger am Ende ein wenig schief aussieht, wird er es gerne bringen. Händler und Kunden müssen ihm da aber schon ziemlich vertrauen, oder?
Sie werden jetzt vielleicht eine Vorstellung davon bekommen haben, wieso es so große Preisunterschiede bei den Tonabnehmern gibt.
Das untere Ende der Fahnenstange bildet die Bulk-Ware, also Blister-Verpackungen, auf denen 50 oder 100 Tonabnehmer zu finden sind. Die Endkontrolle findet hier beim Kunden statt. Dies bedeutet, dass der Hersteller möglicherweise gar nicht weiß, ob er etwas Funktionierendes oder Ausschuss produziert hat. Der Händler kauft eine “Liefereinheit” und der Preis dafür ist so kalkuliert, dass er einen großen Teil der Ware einfach wegschmeißen kann.
Stellt der Endverbraucher nach dem Kauf fest, dass der Tonabnehmer nicht oder nicht richtig funktioniert, bekommt er eben ein anderes. Wenn er es denn merkt. Ob er ein richtig gut funktionierendes System erworben hat oder eines, das eben geradeso funktioniert, ist Zufall – so wie beim Losekaufen. Die meisten Lose sind Nieten, man kann aber auch Glück haben.
Die zweite Stufe bilden die Tonabnehmer, die einzeln verpackt angeboten werden. Hier ist i.d.R. sichergestellt, dass sie auf ihre Funktion hin geprüft worden sind.
Noch besser sind dann die Tonabnehmer, bei denen die Einhaltung bestimmter Mindestwerte zugesagt wird. Oftmals liegen diesen Systemen auch die Mess-Schriebe bei.
Wenn Sie sich jetzt fragen, was denn mit den Tonabnehmern geschieht, die bei der Prüfung durchfallen, dann gehen Sie doch einfach noch einmal ein paar Zeilen zurück und lesen Sie bei „Die zweite Stufe …“ weiter. 🙂
Die vierte Stufe wird dann von den Tonabnehmern gebildet, die so entwickelt und angefertigt worden sind, dass sie ganz besondere Messwerte erreichen.
Sind also die Messwerte das A&O eines Tonabnehmers?
Im Prinzip schon.
Immer wieder wird es einen Tonabnehmer mit schlechten Messwerten geben, der doch einen ganz individuellen Reiz besitzt. Aber das ist dann so wie die Fotos einer Lochbild- oder Lomo-Kamera.
Irgendwie faszinierend, aber qualitativ doch völlig daneben.
Leider muss man aber auch sagen, dass selbst die allerbesten Messwerte kein Versprechen für einen tollen Klang sind. So einen teuren Tonabnehmer, den sollte man sich deshalb unbedingt ganz bewusst und sorgfältig auswählen und nur bei dem zugreifen, der den eigenen Geschmack am besten trifft.
Fassen wir zusammen:
Eigentlich sollte von Haus aus alles „im Lot“ und eine Korrektur durch Schiefstellen der Headshell indiskutabel sein. Allerdings gibt es konstruktive Gründe, durch die eine Azimuth-Justage unverzichtbar werden kann.
Dann gibt es noch Fehlstellungen durch eine ungenaue Herstellung und am Ende gibt es eine optische Fehlstellung, durch die aber die maximale Leistung des Tonabnehmers erst gewährleistet wird.
Solche Dinge wie schiefe Plattenteller oder Tonarmbasen können wir ja noch mit dem bloßen Auge erkennen und was dagegen tun, aber wie finde ich denn heraus, ob mein Tonabnehmer aus Versehen oder absichtlich schief hergestellt worden ist?
Hier müssen wir folgende Varianten unterscheiden:
Schiefer Diamant
Ich kenne keinen Tonabnehmer-Hersteller, der seine Diamanten absichtlich schief einbaut, um noch bessere Messwerte zu erhalten. Diamanten werden nicht einzeln, sondern bereits auf dem Nadelträger fertig montiert geordert.
Wer als Hersteller einen Nadelträger mit schief montiertem Diamanten akzeptiert, der hat gar nicht vor, den weltbesten Tonabnehmer zu produzieren.
Die Frage ist ja auch, ob die Nadel schief montiert worden ist, oder ob nicht eher der Hersteller den Nadelträger leicht verdreht montiert hat.
So oder so: Ein System mit schief sitzendem Diamanten gehört vom Endverbraucher nicht „ausgeglichen“ sondern reklamiert!
Schiefer Nadelträger bei Serien-Produkten
Es liegt ein Produktionsfehler vor und das System sollte sofort wieder zurückgeben werden.
Schiefer Nadelträger bei hochwertigen Einzel-Produkten
In diesem Fall sollten wir davon ausgehen, dass die Schiefstellung das Ergebnis einer peniblen Justage ist, auch wenn das jetzt ziemlich dreist wirken mag. Um hierfür eine Bestätigung zu erhalten, sollten wir das System beim Händler durchmessen lassen oder es selbst durchmessen.
Vorsicht vor Sonderangeboten bei Tonabnehmern!
Einerseits ist es natürlich ganz toll, wenn man bei einem teuren Tonabnehmer ein paar Hundert Euro sparen kann und zum Beispiel statt 800,- € nur 500,- € bezahlt hat. Wenn man aber 500,- € für einen Tonabnehmer bezahlt hat, der bereits reklamiert wurde und keine 200,- € Wert ist, dann stimmt das mit der Sparerei nicht mehr so ganz, oder?
Bitte merken:
Wenn ein 800,- €-Tonabnehmer reklamiert werden durfte, dann ist er defekt und selbst ein intaktes 200,- Euro-System klingt im Vergleich deutlich besser!
Könnte man ihn einfach instandsetzen, hätte der Hersteller das schon selbst veranlasst. So ein System klingt nicht gut und im schlimmsten Fall machen Sie sich mit ihm Ihre schönen Platten kaputt!
Am sichersten ist es, Sie kaufen einen Tonabnehmer vor Ort bei einem kompetenten Händler, bei dem der Einbau zum Service dazugehört. Und wenn es irgendwie geht, dann sollte auch eine Messung zum Service dazugehören.
Wieso Händler äußerst ungern messen
Jedes Messergebnis ist ein Resultat aus der Kombination Laufwerk-Tonarm-Tonabnehmer. Der allerbeste Tonabnehmer kann in einem nicht optimal passenden Tonarm keine „Wundermesswerte“ erreichen. Will der Kunde mit diesem Arm aber unbedingt genau diesen einen “Traum-Tonabnehmer kaufen, dann liegt es nicht im Interesse des Händlers, ihm durch entsprechende Messungen zu beweisen, dass das in diesem Fall Unsinn ist.
Kann man Tonabnehmer selber messen?
Grundsätzlich können Sie alle Messgeräte des Marktes auch als Endverbraucher erwerben. Es gibt da keine, die dem Fachhandel vorbehalten sind. Aus Kostengründen werden Sie als Kunde aber wohl darauf verzichten wollen.
Preisgünstig sind Mess-Schallplatten, die der Markt immer noch anbietet und mit denen man die wichtigsten Einstellungen ganz gut nach Gehör beurteilen kann.
Ein Zwischending ist die Software des Herrn Dr. Feickert. Wer häufiger selbst Tonabnehmer justiert und den Händlern an seinem Wohnort nicht vertraut, ist damit gut gerüstet. Hierbei werden fünf verschiedene Headshell-Stellungen durchgemessen (-2°, -1°, 0°, +1°, +2°), um aus allen fünf Messkurven die optimale Azimuth-Einstellung erkennen zu können.
Eine solche Messung ist ideal – ja fast schon genial — da sie wirklich alle Parameter des Laufwerks, des Tonarms und des Tonabnehmers im Zusammenspiel berücksichtigt – und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch!
Für einen Händler ist auch diese Software ein „zweischneidiges Schwert“, denn kaum ein Kunde wird sich darüber freuen, einen optimal justierten – aber schief stehenden Tonabnehmer ausgehändigt zu bekommen, oder?
Sie sollten jetzt in der Lage sein, die Bemühungen des Händlers zu verstehen und in einem Gespräch mit ihm herausfinden können, was tatsächlich hinter seiner “schiefen Azimuth-Einstellung” stecken könnte. [...]
Lesen Sie weiter ...
5. Dezember 2021HiFi-HandbuchElektrischer Abschluss von Tonabnehmern
Vorwort:
Das Thema “elektrischer Abschluss von Tonabnehmern” ist keines, bei dem sich alle einig sind.
Bereits in den 80-er Jahren hatte ich alle „großen“ und „kleinen“ Tonabnehmer-Hersteller angeschrieben, um von ihnen einen fachlich korrekten Bericht zum Thema „elektrischer Abschluss eines Tonabnehmers“ zu bekommen, den ich in meiner kleinen HiFi-Zeitschrift veröffentlichen wollte.
Jedoch kein einziger Hersteller war damals bereit, sich dazu schriftlich zu äußern.
Irgendwie hatte ich in ein Wespennest gestochen und alle forderten mich auf, mich auf der Stelle nicht mehr zu bewegen, in der Hoffnung, die Wespen würden sich wieder beruhigen.
Einzig und allein Klaus Renner, den Herausgeber der Kult-Zeitung „Das Ohr“, konnte ich dafür gewinnen, sich zu diesem Thema zu äußern.
Seitdem hört man sowohl von den Tonabnehmer-Produzenten als auch von den Phonoteil-Entwicklern immer wieder die Aussage, dass es „jetzt aber wirklich völlig gleichgültig geworden sei, wie man ein MC-System elektrisch abschließt, ab sofort hätte es keinerlei klangliche Auswirkungen mehr.“
Und fast 30 Jahre nach meinen ersten Bemühungen muss ich erkennen, dass ich immer noch ein Thema anspreche, bei dem sich die „HiFi-Druiden“ gegenseitig die Zaubersprüche um die Ohren hauen, um einander größtmöglichen Schaden zuzufügen.
Immer mehr glaube ich aber, dass es dabei weder um die fehlende Kunst des Erklärens noch um unterschiedliche Ansichten geht – es scheint viel mehr das Problem vor zu liegen, dass niemand so recht in der Lage ist, die Problematik gänzlich zu beseitigen.
Ein Problem fehlender Standards?
Im Computer-Bereich gibt es das „Open-Source-Problem“. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, alle dürfen auch noch drin rumrühren und keiner sorgt dafür, dass etwas zueinander kompatibel ist.
Dagegen steht die Apple-Philosophie, die darauf achtet, dass alle Dinge miteinander harmonieren. Zumindest in der Theorie.
Braucht die Analog-Szene ebenfalls so eine übergeordnete Stelle? Bei der sowohl die Tonabnehmer- als auch die Phonoteil-Hersteller ihre Neuentwicklungen immer erst freigeben lassen müssen?
Um Himmels Willen nein, bloss nicht!
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann ist das doch das Spannende an dieser analogen Sache. Ich kriege einen neuen Tonabnehmer oder ein neues Phonoteil und kann mich Stück für Stück hineinhören. Erst mit einer Grundeinstellung (Leerlauf) beginnen und dann mit verschiedenen Variationen austüfteln, wie es wohl noch besser werden könnte.
Wie viele Überraschungen habe ich da schon erlebt!
Und das soll dann alles vorbei sein?
Sie werden jetzt vielleicht denken:
„Ja, Du weißt ja auch, was Du zu machen hast, aber was ist mit mir?“
Für Sie – schreibe ich gerade diesen Beitrag!
Lesen Sie ihn und danach werden Sie ebenfalls wissen, was zu machen ist. Vielleicht wissen Sie dann immer noch nicht, wieso Sie das tun, aber was zu tun ist, das sage ich Ihnen jetzt.
MM-System (moving-magnet)
Bei einem MM-System brauchen wir uns um den Abschlusswiderstand keine Gedanken zu machen. MM-Eingänge sind grundsätzlich mit 47 KOhm abgeschlossen. Da gibt es für Sie gar nichts zu tun.
Empfindlich reagiert ein MM-System schon mal auf einen völlig falschen Kapazitätswert des angeschlossenen Kabels. Hierbei zählt die vollständige Verkabelung – angefangen von den kleinen Steckschuhen am Tonabnehmer bis hin zu den Cinch-Steckern und alles zwischendurch sowieso. Die Summe aller Kapazitäten ist entscheidend.
Ein Wert von 150pF wird dabei als optimal und gleichzeitig auch maximal betrachtet. Echte Tonarmkabel haben daher in der Regel auch sehr niedrige Kapazitätswerte, denn hinzufügen, was zu wenig ist, das geht durchaus. Liegt die Kapazität des Anschlusskabels aber zu hoch, gibt es keine Abhilfe.
Kann man die Kapazität des Kabels selber messen?
Einfacher als zu messen ist es, in die technischen Daten des Kabels zu schauen. Liegen die bei unter 100 pF/m und ist das Kabel auch nicht länger als 1m, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Wenn Sie aber über ein entsprechendes Messgerät verfügen und damit umgehen können, ist das Messen auch keine Zauberei. Denken Sie nur daran, die Schuhe am Tonabnehmer vor der Messung abzuziehen, sonst messen Sie den Tonabnehmer mit!
Sofern das Gesamt-Ergebnis unter 150pF bleibt, werden Sie feststellen, dass auch klanglich alles in Ordnung ist. Wenn man will, kann man diesen Wert exakt anpassen, aber man sollte sich davon nicht zu viel versprechen.
Wenn Sie jedoch ein MM-System betreiben und den Eindruck haben, dass es weit entfernt von seinen klanglichen Fähigkeiten läuft, dann sollten Sie das Kabel mal durchmessen lassen, oder sich die technischen Daten ansehen. Möglicherweise liegt die Kapazität des Kabels ja doch zu hoch und vielleicht steckt hier ja die Ursache für einen nicht so tollen Klang.
MC-System (moving-coil)
Beim MC-System kehren sich die Anforderungen um. Hier spielt der Kapazitätswert keine Rolle. Um so bedeutender wird der korrekte Abschlusswiderstand. Stimmt er nicht, wirkt sich das unter Umständen (bei dem einen Tonabnehmer mehr bei dem nächsten weniger) auf die Lautstärke, sowie auch auf die elektrische Bedämpfung des Nadelträgers und damit eben auch auf das gesamte Klangbild aus.
Wird ein MC-Tonabnehmer mit einem zu niedrigen Wert abgeschlossen, wirkt sein Klangbild „müder“ – aber es gewinnt an räumlicher Tiefe.
Wird ein MC-Tonabnehmer mit einem zu hohen Wert abgeschlossen, klingt es „dünner“, „harscher“ und einfach „nervös“.
Es sei denn, man wählt einen viel zu hohen Abschlusswiderstand.
Der Wert, ab wann dieser Widerstand „viel zu hoch“ ist, der hängt vom eigenen Innenwiderstand des Tonabnehmers ab. Bei manchen Tonabnehmern reichen schon 300 Ohm – bei anderen muss man auf über 2.000 Ohm gehen. Von diesem Wert an verändert sich klanglich überhaupt nichts mehr. Ob wir also 2.000, 20.000 oder die 47.000 Ohm des MM-Eingangs verwenden, ist völlig gleichgültig.
Herbert Schleicher, der mir in den 80-er Jahren das „analoge Laufen“ beigebracht hat, nannte diesen Zustand „Leerlauf“.
Auch wenn ich bis heute nicht in der Lage bin, diesen Zustand fachlich korrekt zu erläutern, kann ich bestätigen, dass ein MC-System im „Leerlauf“ bereits sehr viel von seinen Fähigkeiten zeigen kann. Um eine Zahl zu nennen, würde ich mich darauf festlegen, dass es uns etwa 90% seiner Fähigkeiten zeigt. Und was wichtiger ist: Es gibt uns einen Hinweis darauf, welche klangliche Ausrichtung es von Hause aus mitbekommen hat.
Wenn Sie über ein MC-System gar nichts wissen und herausfinden wollen, wie es „wohl klingen kann“, dann wählen Sie sicherheitshalber einen Abschlusswiderstand höher als 2.000 Ohm und Sie werden es kennenlernen können. Mit diesem Klangbild im Ohr können Sie dann mit verschiedenen Widerstandswerten experimentieren und brauchen einfach nur hinzuhören, wie sich das Klangbild entwickelt. Sie haben dann den richtigen Wert gefunden, wenn es wieder so klingt, wie im Leerlauf, aber doch an Qualität gewonnen hat, wenn also auch die letzten 10% noch hinzugekommen sind.
Wobei Sie da nicht ängstlich sein sollten und ruhig Ihren eigenen Geschmack als Maßstab nehmen dürfen.
Ortofon-Systeme, die bis etwa 1992 gebaut worden sind, dürfen mit höchstens 30 Ohm betrieben werden und fühlen sich so bei 15 bis 20 Ohm richtig wohl. Madrigal-Systeme brauchten zwingend 850 Ohm.
Audio-Technica zeigte es dann anfangs der 90-er Jahre allen anderen und legte seine hochwertigen Tonabnehmer vollständig auf exakt 100 Ohm aus.
Dies war ein genialer Schachzug, denn fast alle in Verstärkern fest integrierte MC-Eingänge sind mit 100 Ohm abgeschlossen. Diese 100 Ohm gelten sozusagen als Standard. Ein Audio-Technica-System passte damit immer und hatte „die halbe Miete schon im Sack“.
Ein MC 30 von Ortofon musste außen vorbleiben, denn mit 100 Ohm klang es gruselig!
… und verändern konnte man das an den Verstärkern eben meistens nicht.
Ortofon setze deshalb zu dieser Zeit verstärkt auf die Nutzung von Übertragern.
Übertrager arbeiten ähnlich wie Transformatoren. Es gibt also einen „Primärstrom“ und einen „Sekundärstrom“, wodurch beide „elektrischen Seiten“ völlig voneinander getrennt werden.
Je nach Ausführung können wir durch Übertrager/Transformatoren den Strom erhöhen (also zum Bespiel von 12V auf 230V) oder absenken (also von 230V auf 12V).
Hat der Übertrager nun in unserem Fall die typische Ausgangsspannung eines MC-Systems von etwa 0,4 mV auf die eines typischen MM-Systems von etwa 5 mV angehoben, kann das MC-System direkt am MM-Eingang des Verstärkers angeschlossen werden und der Abschlusswiderstand spielt keine Rolle mehr.
So richtig genial war diese Vorgehensweise von Ortofon aber nicht, denn erstens wurde der Kunde dadurch gezwungen, noch ein Bauteil mehr einzukaufen und zweitens gab es nicht unerhebliche Preis- und Qualitätsunterschiede zwischen den Übertragern, die der Markt parat gehalten hat.
Fazit:
Sie müssen sich wohl entscheiden, ob Sie denen folgen wollen, die Ihnen sagen, dass das mit dem Abschlusswiderstand bei einem MC-System völliger Blödsinn ist, oder ob Sie Ihre Konstellation zuhause mal darauf prüfen wollen, ob sie elektrisch korrekt angepasst ist.
In den technischen Daten der Tonabnehmer ist meistens ein genauer Wert vorgegeben, den Sie auch einhalten sollten. Ansonsten experimentieren Sie einfach mal ein wenig.
Wie verändert man den Abschlusswiderstand denn überhaupt?
Leider gibt es Phono-Verstärker oder -Eingänge, an denen man gar nichts verändern kann. Das ist jetzt nicht wirklich tragisch und auch kein Beleg für eine schlechte Qualität des Bauteils. Sie sollten dann nur bei der Tonabnehmer-Auswahl darauf achten, dass der empfohlene Abschlusswiderstand auch zum Phonoeingang passt. Mit 100 Ohm liegen Sie eigentlich fast immer goldrichtig!
Kann man diesen Wert bei Ihrem Phonoteil anpassen, gibt es in der Regel zwei Ausführungen.
Mäuseklavier
Die erste Ausführung verfügt über ein so genanntes „Mäuseklavier“. Das ist ein Bauteil mit mehreren kleinen Schaltern drauf. Hier gibt der Hersteller eine kleine Anleitung dazu, die Ihnen verrät, welcher Schalter in welcher Stellung (on oder off) zu stehen hat, um bestimmte Werte zu erreichen. Diese Lösung hat den Vorteil, dass wir keine zusätzlichen Bauteile einkaufen müssen, aber den Nachteil, dass wir mit den einstellbaren Werten auskommen müssen. Macht das Mäuseklavier hier z.B. den Sprung von 100 direkt auf 500 Ohm, dann sollten wir keinen Tonabnehmer betreiben, der mit 350 Ohm abgeschlossen sein will.
Zweites Paar Eingangsbuchsen
Die zweite Möglichkeit ist ein paralleles Paar Eingangsbuchsen. Also über oder neben den Eingangsbuchsen für das Tonarmkabel gibt es noch ein zweites Paar Buchsen. In diese Buchsen können wir nun Cinch-Stecker hineinstecken, in die wir Widerstände gelötet haben.
Wer experimentieren will, der besorgt sich ein paar Stecker und eine Auswahl an guten Widerständen. Eine brauchbare Reihe wäre 20, 50, 100, 350, 500 und 800 Ohm.
Natürlich sollten es nicht die billigsten Widerstände sein. Und wer es den High-End-Entwicklern gleichtun möchte, der kauft von jeder Sorte 10 oder 20 Stück, um zwei absolut gleiche Widerstände heraus suchen zu können.
Aber ganz ehrlich: Übertreiben Sie das nicht!
Wenn Sie kein Lötkünstler sind, ergeben sich schon beim Löten deutlich größere Abweichungen als Widerstände Toleranzen haben dürfen. Und ob Sie den Tonabnehmer jetzt mit 100 Ohm abschließen oder mit 99,998 – das dürfte wohl auch niemand hören können.
Also ich bin da jedenfalls draußen! [...]
Lesen Sie weiter ...